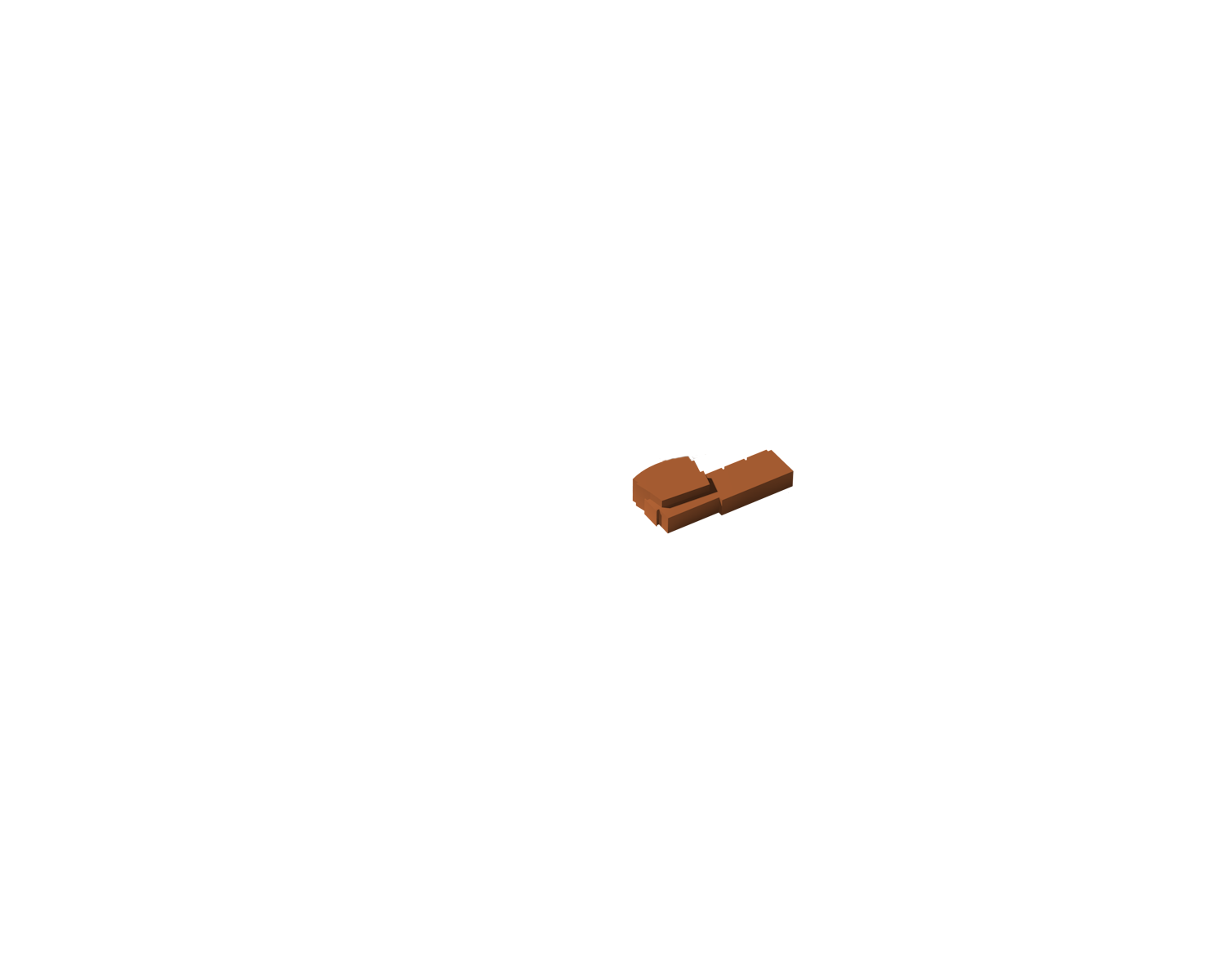Ringvorlesung "Korruption": Korruption als rechtliches Phänomen
Ein Vortrag von Prof. Dr. Eike Albrecht (BTU)
Korruption wird meist als Inbegriff der Wirtschaftskriminalität (sog. „white collar crime“) angesehen. Das liegt auch daran, dass der Begriff der Korruption häufig erst dann in der öffentlichen Wahrnehmung auftaucht, wenn er mit klangvollen Namen wie „Siemens“, oder anderen aufmerksamkeitserweckenden Begriffen wie „Allianz Arena“, „Kassenärzte“, oder „Lustreisen“ in Verbindung gebracht wird.
Dabei stellt sich zunächst die Frage, ob die zunehmende Aufmerksamkeit für Korruption in der öffentlichen Wahrnehmung Folge einer zunehmenden Sensibilisierung oder vielmehr schon Skandalisierung eines an sich gesellschaftlich lange Zeit akzeptablen, wenn nicht gar erwünschten Verhaltens ist? Geht es vielleicht nur um Klimapflege, um ein Kavaliersdelikt in Zeiten einer hysterisch-puritanischen Hypermoralität. Denn das, was heute unter Korruption verstanden wird, ist unter historischem Blickwinkel durchaus „normales“ Verhalten gewesen, unterhielt sich doch der feudalistische Hofstaat im Wesentlichen durch Vergütung politisch-administrativer Dienstleistungen, während die „Vollbesoldung“ der Amtsträger ein neueres Konzept französischen Ursprungs darstellt. Und auch heute sind die Grenzen zwischen noch akzeptabler freundlicher Gesten und Bestechung fließend.
Der BGH löst diese Problematik über eine Prüfung, ob eine Unrechtsvereinbarung vorliegt. Das wird ggf. im Wege wertender Betrachtung aller Umstände des Einzelfalls verneint, z.B. bei Sozialadäquanz. Hierunter fallen kleinere, übliche, im weitesten Sinne höfliche Zuwendungen. Diese sollen kein „Unrecht“ sein. Das betrifft Bewirtungen, Werbegeschenke, wobei sich in der Praxis eine Grenze bei 30‑50 € herauskristallisiert, Trinkgelder, Veranstaltungseinladungen etc. In der wertenden Abgrenzung werden die Stellung und der Inhalt der Dienstaufgaben des Amtsträgers, die Nähe zwischen dienstlichen Aufgaben und Anlass der Vorteilszuwendung sowie die (abstrakte) Möglichkeit zur Beeinflussung der Amtsführung berücksichtigt. Auch beim Sponsoring, also einer Zuwendung in Erwartung werbender Wirkung, werden die Strafvorschriften zurückhaltend angewendet. Beim Einladungssponsoring („Hospitality“) gibt das Verhältnis Veranstaltungszweck – dienstliche Funktion – Werbeeffekt Orientierung. Darunter fallen Auftritte auf gesponserter Wohltätigkeitsveranstaltung oder kostenlose Platzierung in VIP-Loge.
Das Gleiche gilt für Forschung mit Mitteln Dritter. Auch hier ist die Grenze zwischen Korruption und (sogar) erwünschtem Verhalten über die Unrechtsvereinbarung zu lösen. Diese ist nicht gegeben, wenn in der Sache selbst Forschungsförderung überhaupt vorliegt (und nicht die Zuwendung rein privater Vorteile) und formal das hochschulrechtlich vorgeschriebene Verfahren eingehalten wird (§ 56 Abs. 3 ff. BbgHG).
Nicht nur die Abgrenzung zwischen sozialadäquatem oder sogar erwünschtem Verhalten ist schwierig, auch der Begriff der Korruption ist verschwommen und strafrechtlich noch nicht einmal definiert. Im Strafgesetzbuch fallen unter die „Korruptionsdelikte“ die Straftaten „Bestechung“, „Bestechlichkeit“, „Vorteilsannahme“, „Vorteilsgewährung“. Tatsächlich werden nicht wenige Korruptionsfälle aber über das Steuerstrafrecht geahndet.
Aus abstrakt-kriminologischer Sicht kann Korruption definiert werden als:
- Missbrauch eines öffentlichen Amtes bzw. einer Funktion in Wirtschaft oder Politik,
- zugunsten eines anderen, auf dessen Veranlassung oder aus Eigeninitiative,
- zur Erlangung eines Vorteils für sich oder einen Dritten, mit Eintritt oder in Erwartung eines Schadens/Nachteils für Allgemeinheit/Unternehmen.
Festzustellen ist auch, dass die rein quantitative kriminologische Erfassung des Phänomens Korruption – wenn auch mit erheblichem Unsicherheitsfaktor – jedenfalls keine dramatischen Entwicklungen zeigt. So schwankt die Zahl der Korruptionsstraftaten zwischen 7.000 und 47.000 Fällen, einer im Vergleich zu ca. 1 Mio. Betrugsdelikten oder 1,3 Mio. Diebstählen geringen Zahl. Allerdings ist das Dunkelfeld groß, denn bei „Korruption“ gibt es keinen unmittelbar Geschädigten. Tatsächlich ist Korruption aber nicht zu unterschätzen, untergräbt es doch das Vertrauen des Bürgers in die unparteiliche und willkürfreie Amtsführung von Behördenmitarbeitern und anderen in öffentlicher Funktion tätigen Personen. Deshalb ist der Bekämpfung der Korruption – auch wenn die Gesamtlage in Deutschland, vor allem im weltweiten Vergleich nicht dramatisch ist – besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Insbesondere sind die organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die Korruption verhindern. Dazu gehören die Durchsetzung des Mehr(als 2-)-Augen-Prinzips, die Trennung von Vorgängen in korruptionsanfälligen Bereichen und Verteilung auf verschiedene Verantwortliche (beispielsweise in Planung, Ausschreibung und Abrechnung), die regelmäßige Rotation von Personal, wo dies möglich ist, und vor allem mit klaren Regelungen und Dienstanweisungen über Annahme von Geschenken und Belohnungen, um Unsicherheiten bei den Beschäftigten zu verhindern und ihnen auch ein Argument gegen den Zuwendenden in die Hand zu geben, und, zu guter Letzt, Beachtung von Indikatoren für Korruption.
Kontakt
Kulturphilosophie
T 2960