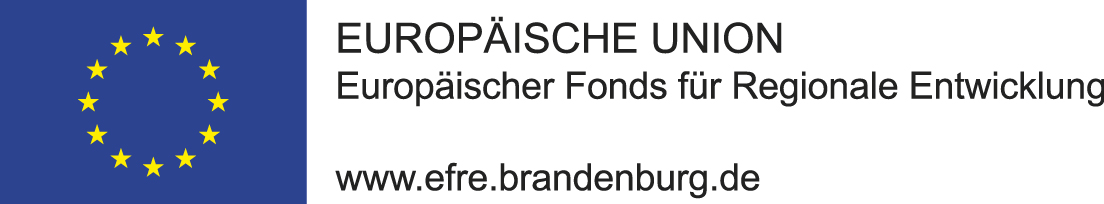
Diese Projekte werden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Landes Brandenburg gefördert:
Quantifizierung von Kohlenstoff- und Stickstoffausträgen in klimaangepassten Anbausystemen
Stickstoff und Kohlenstoff werden in der Landwirtschaft vor allem in Form von Düngemitteln zugeführt, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Wenn jedoch mehr gedüngt wird, als die Pflanzen benötigen, kommt es zu entsprechenden Auswaschungen. Stickstoff wird hierbei vor allem als Nitrat ausgewaschen und kann so unter anderem bei starken Niederschlägen mit dem Sickerwasser in das Grundwasser gelangen.
Erste Studien haben gezeigt, dass die Nährstoffeffizienz in Agroforstsystemen höher ist und im Vergleich zu Monokulturen weniger Düngemittel benötigt werden. Insbesondere die Nitratauswaschungen können durch Gehölzstreifen signifikant reduziert werden. Die genauen Prozesse, die zu dieser erhöhten Nährstoffeffizienz führen, sind jedoch noch teilweise unklar und von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise der Bewirtschaftung, der Ausprägung des Agrarholzsystems sowie den klimatischen und standörtlichen Gegebenheiten, abhängig. Infolgedessen ist die Quantifizierung der reduzierten Düngemittelmengen in Abhängigkeit von standortspezifischen Parametern weiterhin schwierig. Durch die beantragte Geräteinvestition können Sickerwasser- und Grundwasserproben hinsichtlich ihrer Kohlenstoff- und Stickstoffkonzentration analysiert werden. Dadurch lässt sich quantifizieren, wie sich ein klima- und standortangepasstes Düngeregime auf die Nährstoffauswaschungen im Sickerwasser auswirkt, und entsprechend kann eine vollständige Kohlenstoff- und Stickstoffbilanz aufgestellt werden. Durch die Quantifizierung der verringerten Düngemittelmenge kann die wirtschaftliche Attraktivität von Agroforstsystemen erhöht und somit die Akzeptanz bei den Landwirten gesteigert werden.
Jahr der Bewilligung: 2024
Gewährter Betrag: 32.940,00 €
Optimierung der bodenchemischen Analysekapazitäten zur Untersuchung der Stabilität von organischer Bodensubstanz in klimaangepassten Anbausystemen
Brandenburg zählt in Deutschland zu den Regionen, die großflächig durch eher ertragsarme Böden und ein sub-kontinentales, trockenes Klima geprägt sind. Vorherrschend sind sandige, häufig humusarme Böden, die nur ein geringes Speichervermögen für Wasser und Nährstoffe aufweisen. Der wichtigste Faktor für die Steuerung der Wasserhaltekapazität, sowie der Nährstoffspeicherung und -verfügbarkeit ist dabei der Gehalt an organischer Bodensubstanz. Neben den direkten Konsequenzen auf die Bodenfruchtbarkeit, hat die Stabilität der organischen Bodensubstanz zudem einen erheblichen Einfluss auf die CO2-Bilanz von landwirtschaftlichen Flächen. Die organische Bodensubstanz besteht zur Hälfte aus Kohlenstoff, der beim Abbau als Kohlenstoffdioxid (CO2) freigesetzt wird. Bei höheren Temperaturen werden im Boden die Umsetzungsprozesse beschleunigt, sodass es zu einer positiven Rückkopplung zwischen Klimaerwärmung und weiterer CO2-Freisetzung aus dem Boden kommt. Noch ist nicht vollständig geklärt, wie stark diese Umsetzungsprozesse durch eine veränderte Bewirtschaftung zusätzlich beeinflusst werden können. Auf Grund der Bedeutung der organischen Bodensubstanz müssen daher bei der Entwicklung von nachhaltigen Landnutzungsstrategien die potentiellen Auswirkungen auf die Qualität der organischen Bodensubstanz berücksichtigt werden. Ziel des Projektes ist es Bodenproben von unterschiedlichen landwirtschaftlichen Flächen hinsichtlich der Stabilität ihrer organischen Bodensubstanz zu untersuchen, um so Rückschlüsse auf den Einfluss der Bewirtschaftungsform ziehen zu können.
Jahr der Bewilligung: 2023
Gewährter Betrag: 32.844,00 €
Boden-CO2-Flüsse in gestörten Landschaften
Böden stellen eine wichtige Senke für Kohlenstoff dar und vermindern den CO2-Gehalt der Atmosphäre. Somit haben Untersuchungen der Wechselwirkungen zwischen Boden - Vegetation - Atmosphäre eine hohe Bedeutung für das Verständnis der CO2-Flüsse und deren grundlegenden ökologischen und physiologischen Prozesse.
Im Rahmen des Projektes wird der CO2-Gastausch zwischen Boden und Atmosphäre mit modernster Gasanalyse-Technik kontinuierlich erfasst, so dass Gesamt-Kohlenstoffbilanzen berechnet werden. Durch den Einsatz von neuen transparenten Küvetten lassen sich nun Netto-Photosynthese und Atmung bilanzieren, was neue Anwendungsfelder in der Bodenforschung erschließt. In einem ersten Langzeit-Versuch werden Untersuchungen in der Bergbaufolgelandschaft durchgeführt. Ziel ist es die Boden- und Ökosystementwicklung durch Vergleich der Atmung (Verlust) und Photosynthese (Gewinn) und deren Verhältnisse zu charakterisieren.
