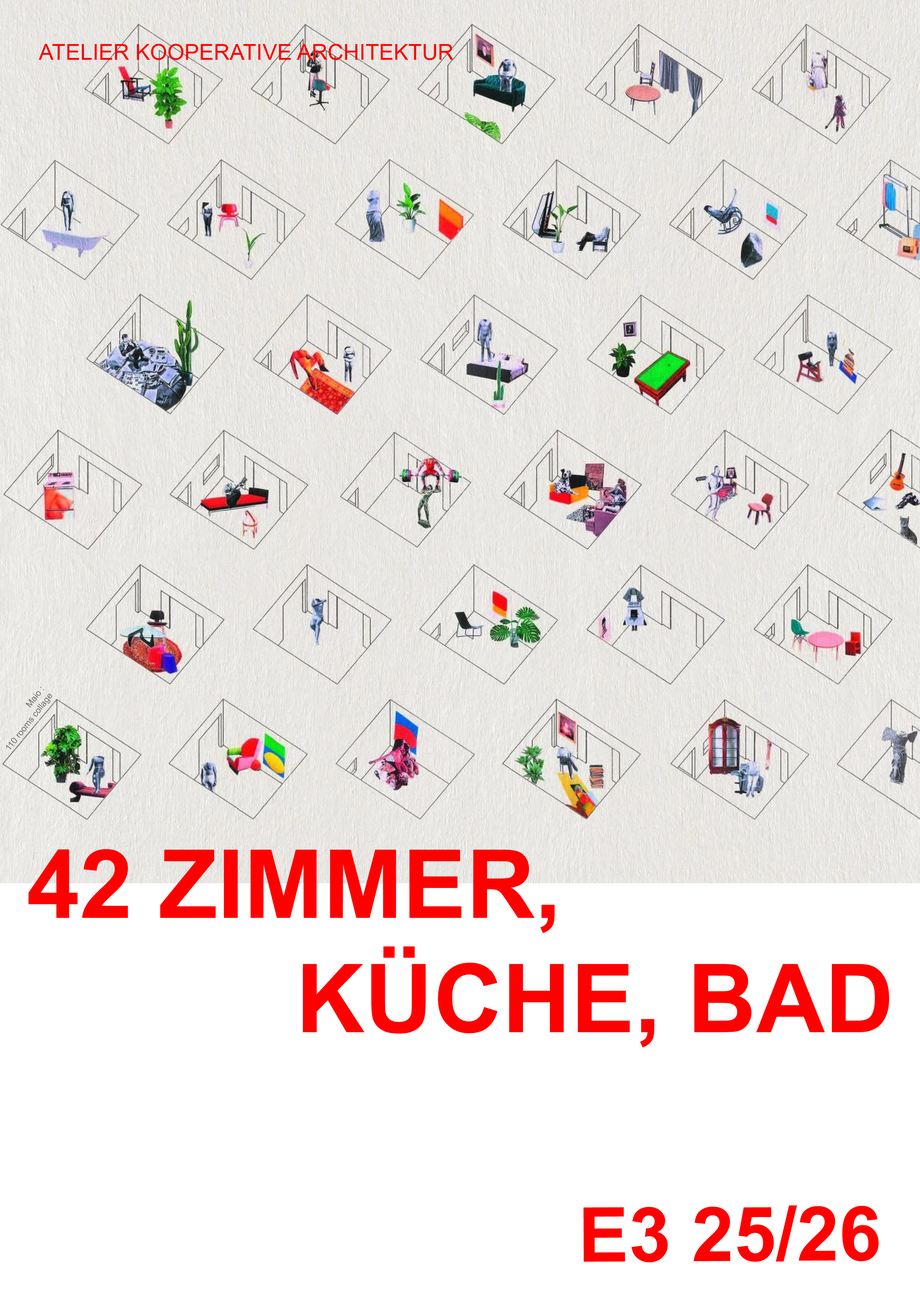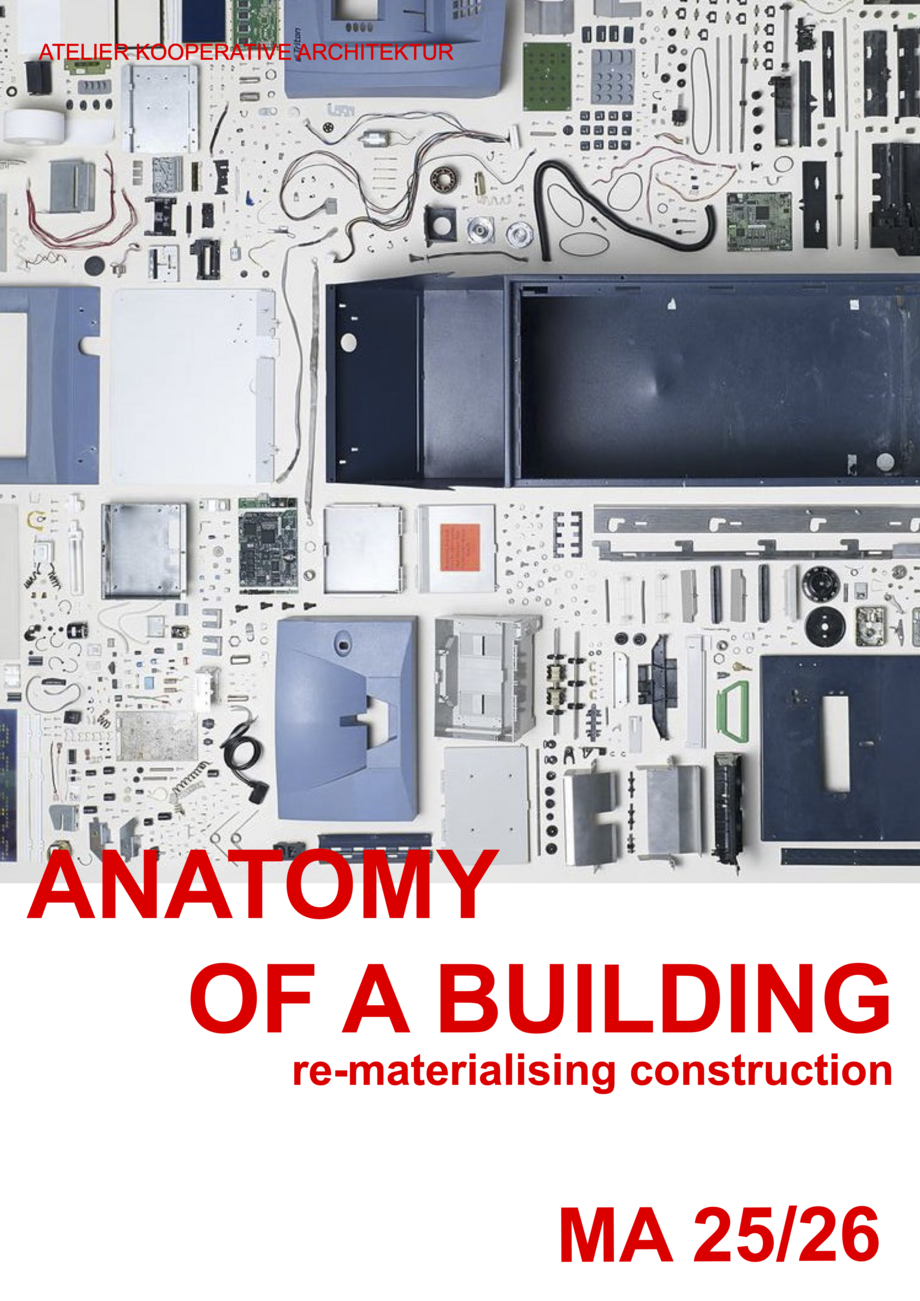
ANATOMY OF A BUILDING Entwurf
Master , E1/ E2/ E3
„… re- materialising construction, a twofold pathway toward reframing the entire sector by promoting both building materials that have little impact on the environment and the repeated reuse of materials after their conventional use cycle“
– William McDonough and Michael Braggart,
Cradle to Cradle: Remaking the Way we make Things
In diesem Semester werden wir uns mit dem industriellen Wohnungsbau in Großplattenbauweise – insbesondere dem Typ WBS 70 beschäftigen.
Die Wohnungsnot nach dem zweiten Weltkrieg und die industrielle Entwicklung Brandenburgs und anderen Regionen erforderten eine schnelle und kostengünstige Bereitstellung von Wohnraum. Der in den 70er Jahren in der DDR weiterentwickelte Plattenbau Typ WBS 70 ermöglichte mit seinem modularen 1,20 m x 1,20 m Baukastensystem und bis zu 6 Meter spannenden Deckenplatten die serielle Errichtung ganzer Wohnkomplexe in Rekordzeit – bis zu 644.900 Wohnungen wurden auf diese Weise gebaut.
Seit der Wende 1990 hat sich die Situation geändert: Bevölkerungsrückgang, Leerstand, Überalterung der Bausubstanz und veränderte Anforderungen an das Wohnen fordern uns als Architekt*innen heraus, mit den bestehenden Plattenbaustrukturen verantwortungsvoll umzugehen. Der Umbau bestehender Gebäude gilt heute oft als die nachhaltigste Lösung – aber ist das auch auf die Plattenbauten in strukturschwachen Regionen übertragbar?
Im Rahmen der Semesteraufgabe “anatomy of a building - re-materialising construction” werden wir untersuchen, inwieweit die Plattenbauten selbst als Ressource verstanden werden können. Können wir ihre Bestandteile so rückbauen, dass sie unschädlich und wirtschaftlich wiederverwendbar sind? Welche Spielräume und Konstruktionsmöglichkeiten eröffnet ein solcher Umgang mit dem Bestand? Und können wir die Gebäude als Materiallager betrachten, deren Elemente in neuen architektonischen Kontexten weiterleben können?
Unser Fokus liegt auf der anatomischen Analyse des WBS 70: Wir werden seine Konstruktionsprinzipien nachvollziehen, seine Bauteile katalogisieren und Möglichkeiten entwickeln, wie diese Elemente in zukünftige Entwurfsstrategien eingebunden werden können. Ziel ist es, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie wir mit scheinbar obsoleten Strukturen kreativ, kritisch und zukunftsgerichtet umgehen können.
E3 - 42 ZIMMER, KÜCHE, BAD Entwurf
Bachelor, 3. Semester
Unter dem Druck der dringenden Wohnungsfrage entstanden in den 60 und 70er Jahren eine Vielzahl an Wohnungen - zumeist in den Peripherien der Stadt und unter dem Versprechen, dass “allen alles gehört” und “jede*r gleich gut wohnen” soll. Dieses Versprechen übersetzen wir in die heutige Zeit und in die Innenstadt - wo die Wohnungsfrage wieder dringend geworden ist.
Wir widmen uns dieses Semester dem gemeinschaftlichen Wohnen im gemeinsamen Eigentum. Wir hinterfragen das Konzept typischer Kernfamilien-, Pärchen- und Single-Wohnformen und gestalten gemeinschaftliche Lebensräume für eine Gruppe von insgesamt 42 Menschen. Dafür entwerfen wir zunächst eine einzelne Wohneinheit als unabhängigen Prototyp. Angepasst auf die zeitgenössischen Zielstellungen des Zusammenlebens werden diese Module im nächsten Schritt multipliziert, durch Gemeinschaftsflächen erweitert und zu verschiedenen Typologien organisiert. Nach einer städtebaulichen Analyse wird die entstandene Struktur in das Baufeld implementiert. Wie wirkt sich eine gemeinschaftliche Wohn- und Eigentumsform auf die Raumbedarfe der Bewohner*innen und damit die Grundrisse aus? Wie können wir flexible Strukturen für sich ändernde Bedürfnisse schaffen? Was ist der Mehrwert von “Alles Allen!”?
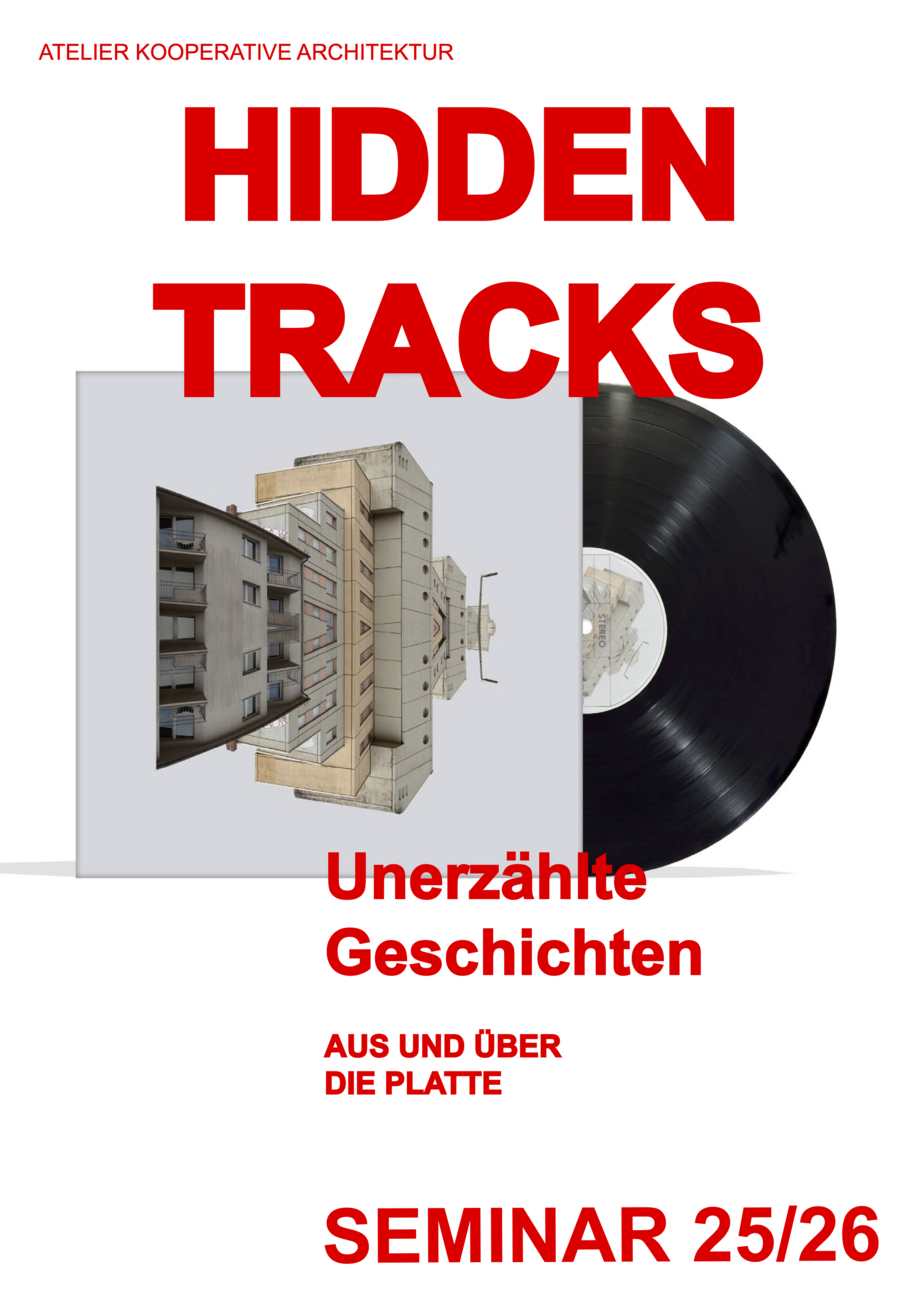
HIDDEN TRACKS : unerzählte Geschichten aus und über die Platte Seminar
Wahlpflicht Bachelor + Master
Zu zehntausenden in den Nachkriegsjahren gebaut, werden Plattenbauten und ganze sogenannte “Neubaugebiete” seit den Nachwende-Jahren wieder im großen Maßstab abgerissen. Auch heute, wo die Wohnungsfrage erneut großmaßstäbliche Lösungen fordert, schauen Planer*innen auf die Großwohnsiedlungen der DDR. Im Diskurs darüber fallen häufig die Schlagworte des Um- und Rückbaus. Mit der großflächigen Demontage des baulichen Erbes erfolgt auch eine Demolage einer gesellschaftlichen Identität.
Doch während Planer*innen darüber nachdenken, wie mit den riesigen Strukturen kostengünstig und ressourcenschonend umzugehen sei, bleiben einzelne Biographien dazu unbeachtet. In “Hidden Tracks” nähern wir uns der individuellen und narrativen Bedeutung “der Platte” und wollen die unerzählten Geschichten aus und über Platten sichtbar machen. Wir suchen individuelle und biographische Geschichten rund um “die Platte”: Von der Bewohnung als Kleinfamilie in der DDR oder als Wohngemeinschaft in der Gegenwart bis hin zu Geschichten aus dem Betonwerk im Volkseigenen Betrieb. Wie war es, als diese riesigen Strukturen in die Peripherien der Städte gesetzt wurden? Welche Hausgemeinschaften haben sich gebildet? Wie hat es sich angefühlt, als dieses Zuhause in den Nachwende Jahren abgerissen wurde? Was ist aus dem Versprechen geworden, dass alles allen gehört? Dazu werden wir im Laufe des Semesters Interviews konzipieren und durchführen, die auf Schallplatten gepresst werden. Ergänzt um selbst gestaltete Cover und Booklets, werden so die individuellen Geschichten der “Platte” festgehalten und erzählt.