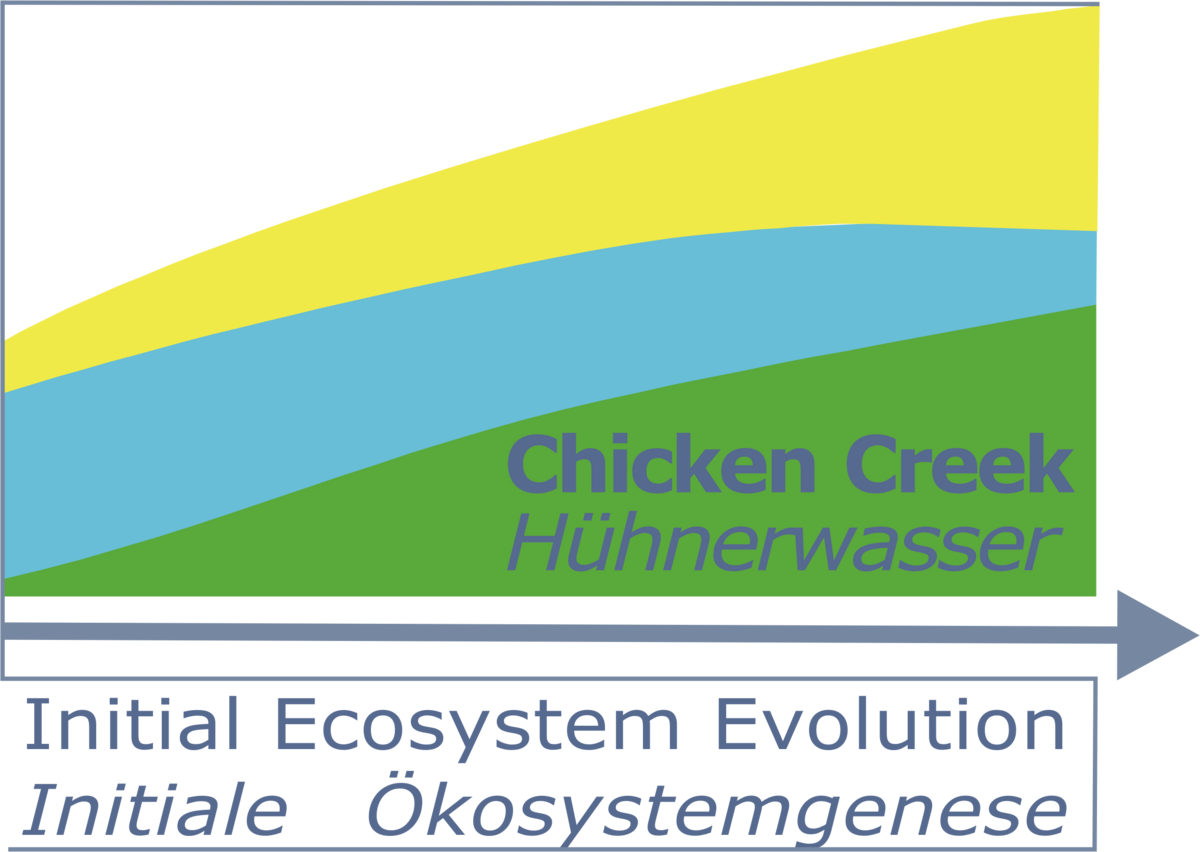Für die Realisierung von Forschungsvorhaben bietet das Zentrum Unterstützung bei der Suche und Nutzung erforderlicher Untersuchungsstandorte in der Lausitz für Feldversuche. Das Zentrum entwickelt und koordiniert zu diesem Zweck das „Living Lab Lusatia“, das verschiedene exemplarische Landschaftsausschnitte aus der im Transformationsprozess befindlichen Lausitz umfasst. Es bietet die Möglichkeit, unter realen Bedingungen Strategien und Konzepte für den Wandel einer Landschaft mit einem hohen Anteil von Marginallandschaften exemplarisch und einschließlich ihrer sozioökonomischen und rechtlichen Komponenten zu untersuchen.
Zu dem Flächenrepertoire des Living Labs zählen Bergbaufolgestandorte in den brandenburgischen Bergbaufolgelandschaften, u.a. die Forschungsplattform "Hühnerwasser". Das Hühnerwasser-Einzugsgebiet dient zum einen als Landschaftsobservatorium der Langzeitbeobachtung von Interaktionen zwischen verschiedenen Ökosystemkompartimenten und Reaktionen auf sich ändernde Umweltbedingungen. Zum anderen bietet es eine Basis für Forschungsprojekte sowie vielfältige Anwendungsgebiete für die Erprobung von innovativer Umweltsensorik. Mit externen Experten wird aktuell eine Bestandsaufnahme der zukünftigen wissenschaftlichen Potentiale dieser Forschungsplattform erarbeitet.
Das Zentrum unterhält den Kontakt zu dem Bergbauunternehmen LEAG und bereitet erforderliche Nutzungsvereinbarungen vor. Auch Standorte außerhalb der Bergbaufolgelandschaften gehören zu dem Landschaftslabor. Aktuell sind dies die Baumuniversität Branitz sowie perspektivisch Freiland-PV-Anlagen. Das Living Lab ist dabei dynamisch angelegt und bietet neben festen Bestandteilen (z.B. Hühnerwasser-Landschaftsobservatorium) die Möglichkeit je nach Forschungsfragestelle relevante zusätzliche Standorte einzubeziehen. Das Zentrum unterstützt die forschenden Fachgebiete dabei durch Vermittlung von Nutzungsvereinbarungen mit Landeigentümern. Es bietet zudem auch fachliche Unterstützung bei der Verarbeitung räumlicher Daten (GIS und Luftbilderstellung) sowie beim Datenmanagement innerhalb von Verbundvorhaben.
Das Landschaftsobservatorium Hühnerwasser ist Teil des weltweiten Netzwerkes von Critical Zone Observatorien (Critical Zone Exploration Network, CZEN).


BodenPotential - Ermittlung der Bodenqualität zur Bewertung der Ertragspotentiale von Rohstoffpflanzen auf marginalen Standorten
Gesamtziel des Vorhabens ist die Konzeption, Entwicklung und Validierung eines neuartigen Bewertungsverfahrens der Bodenqualität hinsichtlich der zu erwartenden Biomasseertragspotentiale ausdauernder Rohstoffpflanzen. Das Verfahren soll dazu dienen, Vorrangflächen für Biomasse- und Nahrungsmittelproduktionsstandorte in der landwirtschaftlichen Beratung zu empfehlen oder in Planungsverfahren auszuweisen. Basierend auf den mit dem Verfahren zu ermittelnden standortabhängigen Biomasseertragspotentialen bietet es zudem für den Landnutzer konkrete Unterstützungsmöglichkeiten zur Entscheidungsfindung bei der Auswahl künftiger Produktionsstandorte für Biomasse zur energetischen und stofflichen Nutzung.
Projektleitung und -bearbeitung: apl. Prof. Dr. Dirk Freese, Dr. Werner Gerwin, Dr. Frank Repmann, Michael Kanzler
Laufzeit: 01.09.2020 - 31.08.2023
Mittelgeber: Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe: BMEL (Projektträger: FNR)


StabilOrg - Verbundvorhaben: „Entwicklung neuartiger, stabiler organo-mineralischer Komplexe zur nachhaltigen Bodenverbesserung (StabilOrg)“; Teilvorhaben 1: „Herkunft und Qualität organischer und anorganischer Komponenten und Bewertung der Mischsubstrate“
Ziel des hier beantragten Verbundvorhabens ist die Herstellung und Erprobung von neuartigen organisch-anorganischen Mischsubstraten aus regional verfügbaren Ausgangsstoffen, die in späteren Vorhaben zu einem vermarktungsfähigen Produkt weiterentwickelt werden können. Anorganische Ausgangsstoffe für die Mischsubstrate sind Eisenhydroxidschlämme (aus Wasseraufbreitungsanlagen) sowie Tone und Lehme.
Projektleitung und -bearbeitung: Dr. Annika Badorreck, Lydia Pohl
Laufzeit: 01.03.2021 - 29.02.2024
Mittelgeber: WIR!: BMBF (Projektträger PtJ)


SoilWater - Verbundprojekt: Bodenöko-Technologie zur Gewinnung von Wasservorrat in gestörten Wäldern; Teilvorhaben: Wasserspeicherung in Böden von Bergbaufolgelandschaften
Ziel von SoilWater ist die Entwicklung von innovativen Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts in Regionen Europas und Ostasiens, um so zur Erreichung des SDG 6 beizutragen. Von zentraler Bedeutung ist dabei eine verbesserte Nutzung des Wasserspeicherpotentials von Waldböden. Ergebnisse der Projektarbeit werden in praxisbezogene Handlungsempfehlungen für Waldbesitzer und Forstverwaltungen zur Optimierung der Wasserspeicherung im Boden von Wäldern einfließen. Das deutsche Teilprojekt im SoilWater-Verbund konzentriert sich exemplarisch auf durch Bergbau stark gestörte Standorte in der Lausitz (Brandenburg). Die Forschungsplattform „Hühnerwasser“ bietet dort mit ihren bereits vorliegenden Langzeitdatenreihen und der Möglichkeit, zusätzliche Dauerbeobachtungen zu etablieren, eine hervorragende Basis für die Identifizierung von Effekten sich entwickelnder Baumbestände auf den Wasserhaushalt eines Ökosystems. Zudem gibt es in dem Braunkohlerevier zahlreiche Standorte, auf denen bereits Daten erhoben worden sind, die für die Ziele von SoilWater genutzt werden können. Die Bergbaufolgelandschaften bieten außerdem beste Möglichkeiten, die zeitliche Entwicklung der Beziehungen zwischen Baumarten, Humusgehalten und Wasserspeicherfähigkeit der sich entwickelnden Böden anhand von Chronosequenzstudien zu untersuchen.
Projektleitung und -bearbeitung: Dr. Werner Gerwin, Michael Kanzler
Laufzeit: 01.06.2020 - 31.05.2023
Mittelgeber: EIG CONCERT Japan (Joint Call 2019: Smart Water Management for Sustainable Society) / BMBF (Projektträger DLR)

Sonderforschungsbereich/Transregio 38 "Strukturen und Prozesse der initialen Ökosystementwicklung in einem künstlichen Wassereinzugsgebiet"
Laufzeit: 2007-2012
Fördermittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Teilprojekt 4: Untersuchungen an einem neu entwickelten Wasserspeichersystem mit Verdunstungsschutz (Capillary Break Technology) zur Sammlung von Niederschlagsabflüssen in Trockengebieten - Projektgebiet Shehan, Jordanien
(Verbundprojekt: IWRM, Israel, Jordanien, Palästina: SMART)
Laufzeit: 2008-2010
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

BMBF-Verbundvorhaben: Bodenmelioration und Anbauverfahren für trockenheitsgefährdete Standorte (BAtroS)
Laufzeit: 2006-2009
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

BMBF-Verbundvorhaben: Nachhaltige Bewirtschaftung von Eichen-Kiefern-Mischbeständen im subkontinentalen Nordostdeutschen Tiefland
Laufzeit: 2005-2009
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Marie Curie Conferences and Training Courses: Modern Agriculture in Central and Eastern Europe: Tools for the Analysis and Management of Rural Change
Laufzeit: 2007-2010
Fördermittelgeber: European Community, Marie Curie Conferences and Training Courses

SENSOR: Sustainability Impact Assessment: Tools for Environmental, Social and Economic Effects of Multifunctional Land Use in European Regions
Laufzeit: 2004-2009
Fördermittelgeber: EU FP6 Integrated Project
Sonderforschungsbereich (SFB) 565: Entwicklung und Bewertung gestörter Kulturlandschaften: Fallbeispiel Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaft
Laufzeit: 2001-2004
Fördermittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
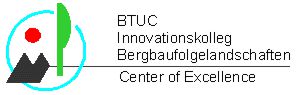
BTUC Innovationskolleg "Ökologisches Entwicklungspotential der Bergbaufolgelandschaften im Lausitzer Braunkohlerevier"
Laufzeit: 1994-1999
Fördermittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)