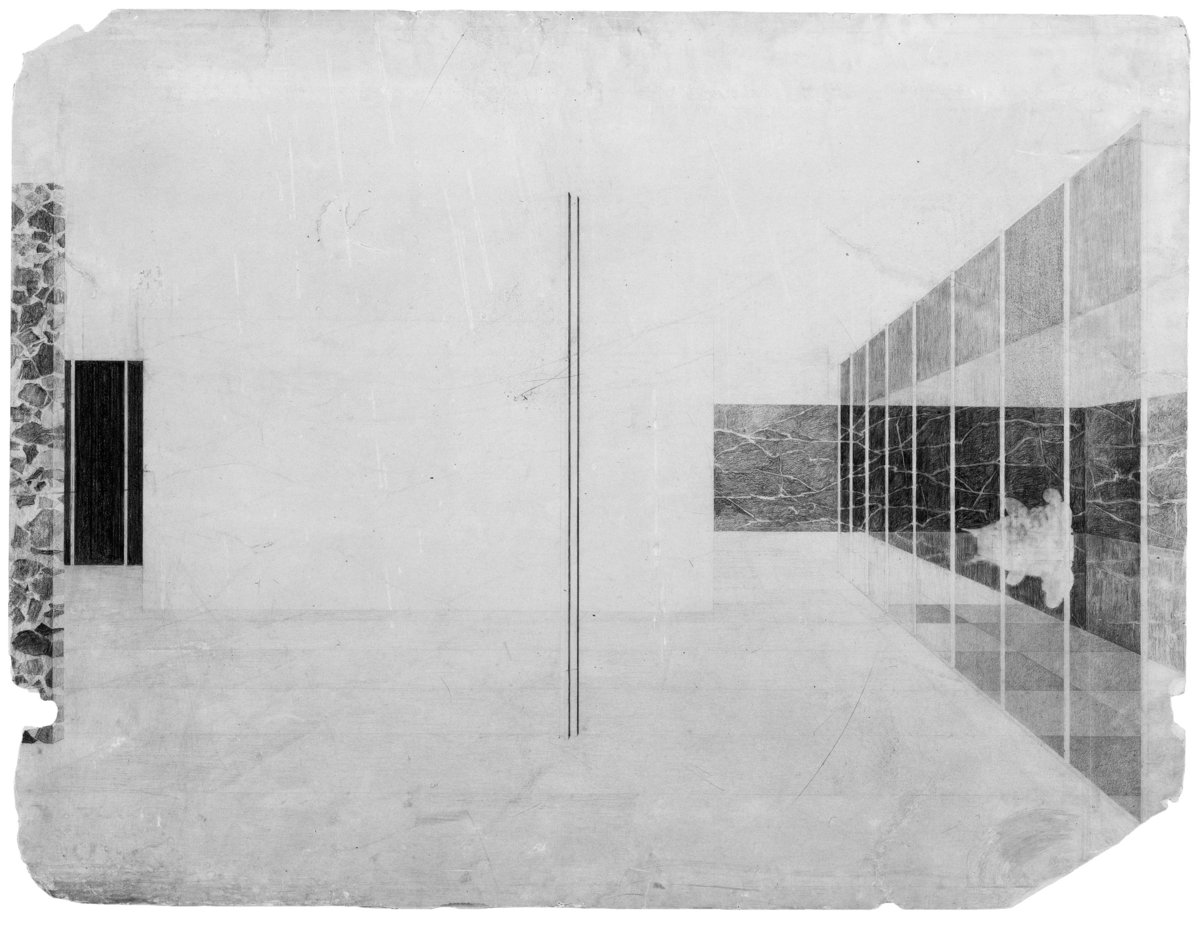»Schönheit ist Natur in der Kunstmäßigkeit«
Friedrich Schiller
Das Nachdenken über das eigene Tun begleitet die Baukunst seit Anbeginn – ein Bauen, das nach den Gründen und Zielen der eigenen Tätigkeit fragt.
Schon die ersten Gründungsmythen suchen den Moment des Errichtens menschlichen Raums in den Bedingungen des Menschseins überhaupt zu fundieren. Das »Aufrichten« und »Raumbilden«, »Fügen« und »Gliedern«, »Setzen« etc. der menschlichen Behausung gehört zu den Urthemen architektonischer Theoriebildung, es entstanden Topoi, die unmittelbar dem Handlungswissen von Architektinnen und Architekten verpflichtet bleiben und doch Ideenbildung betreiben: ob als »Säulenordnung« oder »Proportionslehre«, der »Fassadengestalt« eines Hauses, Fragen der »Raumgliederung«, des »Öffentlichen und Privaten«, der »Stimmung« usw. usf.
Der architekturtheoretische Schriftenkorpus leistet Evidenz darüber und bietet zugleich ein Handlungswissen auf der Metaebene des Bauens. Solche Schriften entstehen als Mainfeste, Traktate, Notate etc. im Zwischenraum von Praxis und Gedanke, Leben und Bedeutung. Davon zehrt die theoretische Reflexion bis heute – dass sie nahe an den Phänomenen bleibt und sich, wie das Bauens selbst, aus der Widerständigkeit von Konstruktion, Material, Nutzungsansprüchen etc. entwickelt. Die »Theorie der Architektur« ist zudem Mittlerin zwischen vielfältigen Wissensfeldern, verbindet die Ideen- und Kulturgeschichte mit der Ebene des Herstellens und Nutzens im Erfahrungsraum des Gebauten. Der zentrale Gegenstand ihrer Auseinandersetzung ist somit das Bauwerk als konkreter Ideenträger. In diesem Sinn bleibt die Architekturtheorie einem utopischen Projekt verpflichtet, das aus den Möglichkeiten und Bedürfnisse einer Zeit entspringt, bedürftig nach Kontinuität und Zukunft.
Die Etablierung des Fachs Architekturtheorie an der Hochschule ist jüngeren Datums und steht im Zusammenhang mit dem gesteigerten kritischen Bewusstsein für die Profession, ihre Themen, Motive und gesellschaftlichen Handlungsspielräume. Darin antwortet sie auf die generelle Erfahrungen von »Kontingenz« und »Unübersichtlichkeit«, die westliche Gesellschaften seit der Moderne kennzeichnen. Umso wichtiger erweist sich der gesellschaftspolitische, soziale und daher neuerlich auch intellektuelle Kontext der architektonischen Praxis. Der Anspruch, eine kritische Metaebene zu formulieren, scheidet die Architekturtheorie von der Architekturgeschichte ebenso wie von der Architekturkritik oder Architekturjournalistik.
Das Fachgebiet Architekturtheorie an der BTU Cottbus-Senftenberg, als Teil des Instituts für Bau- und Kunstgeschichte (IBK) an der Fakultät für Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung, legt den Schwerpunkt auf die hermeneutisch-phänomenologische Dimension der Architektur. Der geteilte Erfahrungs- und Verständigungsraum, stets aufs Neue herausgefordert durch die Suche des Menschen nach Sinn und dessen Ausdruck in der Welt der Artefakte, bildet die Grundlage
von Lehre und Forschung am Fachbereich. Eine solche Zugangsweise reklamiert die Außenseiterposition derjenigen für sich, die mitten in der Sache stehen: Sie nimmt weder eine distanziert-akademische Position ein, noch zeigt sie sich als schlichter Begleiter oder Ideengeber, ihr Thema sind die virulente Ideenbedürftigkeit des Menschen sowie seine leibliche Sinnlichkeit.
In einer Zeit der trennenden Spezialisierung und zersetzenden Ökonomisierung von Alltag und Baupraxis, kann ihre kritische Distanz dabei helfen, Klarheit zu schaffen. Im besten Fall gelingt es, gewachsene Denklinien durch Konfrontation mit der Gegenwart weiterzuentwickeln und so der architektonischen Praxis sowie der Gesellschaft diskursiv Leitbilder zur Verfügung zu stellen.
Geschichte des Lehrstuhls
1994 bis 2010
Eduard Führ, Professor für Architekturtheorie; Gründung des Lehrstuhls
2010 bis 2012
Riklef Rambow, Vertretungsprofessor für Architekturtheorie
2015 bis 2019
Gernot Weckherlin, Vertretungsprofessor für Architekturtheorie
2019 bis 2021
Adria Daraban, Vertretungsprofessorin für Architekturtheorie
2021/2022
Sebastian Feldhusen und Alexander Stumm, Vertretungsprofessoren für Architekturtheorie
Seit 2023
Albert Kirchengast, Professor für Architekturtheorie; Juniorprofessur mit Tenure Track