Vorstudie zur Akzeptanz der Etablierung des professionellen Profils einer »Community Nurse« im Land Brandenburg 2019
Peter Alheit, Kathrin Bernateck, Heidrun Herzberg
Die hier vorgelegte Studie über die Akzeptanz einer modernisierten Variante der ehemaligen „DDR-Gemeindeschwester“ im Land Brandenburg – eben jener Community (Health) Nurse, wie sie international längst etabliert ist – nutzt methodisch eine Diskursanalyse, die interessante Ergebnisse zur Diskussion stellt. Die Befunde lassen sich plausibel in einer Art „Mentalitätsraum“ abbilden. Im Achsenkreuz einer „Strategieachse“ (mit den Kontrastpolen „strategisch-ökonomisch“ vs. „kulturell-kommunikativ“) und einer „Modernisierungsachse“ (mit den Gegensatzpaaren „traditionell-sozial“ vs. „modern-funktional“) kann die Studie vier Diskursvarianten positionieren, die der Einrichtung einer gegenüber dem Prinzip der caring community verpflichteten Pflege mehr oder weniger aufgeschlossen sind: die Argumentationsfiguren „Reformdiskurs“, „Reformpraxis“, „lokale Verankerung“ und „professionelle Enge“. Das zunächst positive Resultat, dass der Kern der Argumentationen in einer „Meinungswolke“ liegt, die vom linken unteren Quadranten bis zum rechten oberen Quadranten des Mentalitätsraums reicht und ihren Schwerpunkt zwischen den Polen „kulturell-kommunikativ“ und „modern-funktional“ (also im linken oberen Quadranten) hat, wird durch zwei Beobachtungen relativiert: (a) verweisen nicht alle der auf den ersten Blick „fortschrittlichen“ Argumentationsfiguren auf praktische Veränderungen; (b) bleibt die Argumentationsfigur „professionelle Enge“, die sich vor allem auf den pflegepolitisch so wichtigen Bereich der ambulanten Pflegedienste bezieht, im Datenmaterial unterrepräsentiert und muss für die zukünftige Entwicklung besonders ernst genommen werden. Auf diese Fragen weist die Studie jedoch mit besonderem Nachdruck hin und verbindet ihre Ergebnisse mit sinnvollen pragmatischen Forschungsdesideraten für die Zukunft der Gesundheitspolitik im Land Brandenburg.
UBICO
Band 1
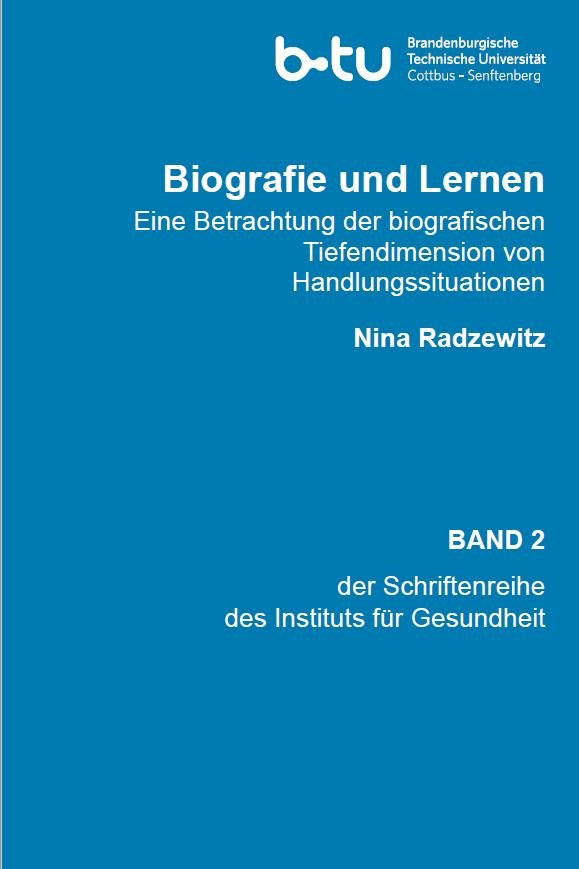
Biographie und Lernen Eine Betrachtung der biografischen Tiefendimension von Handlungssituationen
Nina Radzewitz
Diese Arbeit soll illustrieren, was einen biografischen Forschungszugang zum Thema Lernen auszeichnet. Dazu werden zunächst die Besonderheiten der Ansätze der Biografieforschung im Kontrast zur ‚gängigen‘ Lernforschung skizziert und davon ausgehend eine theoretische Darstellung des biografischen Lernbegriffes vorgenommen. Da in der erziehungswissenschaftlichen Biografieforschung eine Vielzahl theoretischer Konzepte vorliegen, die den Lernbegriff aus verschiedenen Positionen und Forschungsrichtungen beleuchten, ist der Anspruch nicht, einen systematischen Überblick zu geben, sondern nur ein grundlegendes (Vor-)Verständnis darzustellen. Um das komplexe Phänomen des biografischen Lernens darzustellen, werden in dieser Arbeit drei Dimensionen zu Hilfe genommen, die aus der Biografieforschung hervorgegangen sind: die Temporalität, die Kontextualität und die Reflexivität im biografischen Erfahrungsprozess.
Anschließend an die theoretische Betrachtung des Lernbegriffes soll dieser an Forschungsmaterial herantragen werden. Dabei handeltes es sich um kurze Narrationen von Lernenden. Das ausgewählte Material wurde im Rahmen des Neksa-Projekts erhoben. Lernende berichten darin über konkrete berufliche oder lebensweltliche Erfahrungen in verschiedenen Ausbildungsabschnitten bzw. Lebensphasen.
UBICO
Band 2

MTLA im Spannungsfeld zwischen Ausbildungs- und Berufsrealität am Beispiel der Molekularbiologie Eine Triangulationsstudie
Tanja Loof, Sören Thomas
Der Beruf der Medizinisch-technischen Laboratoriumsassistent*innen (MTLA) unterliegt schon immer einer starken, am Fortschritt der biomedizinischen Forschung orientierten, Progression. Aktuell werden immer mehr klassische Analysen durch molekularbiologische Methoden ergänzt bzw. ersetzt. Dies bringt eine starke Erhöhung der Sensitivität und Spezifität mit sich. Zudem ermöglichen diese Methoden einen schnelleren und gezielteren Therapiestart, was einen starken Effekt auf die Patient*innensicherheit hat. In den der MTLA-Ausbildung zugrunde liegenden Ordnungsmitteln sind molekularbiologische Inhalte derzeit jedoch nicht verortet. Ziel dieser Forschungsarbeit war es, eine vermutete Diskrepanz zwischen Ausbildungs- und Berufsrealität in Bezug auf molekularbiologische Methoden empirisch zu belegen und deren Effekte auf berufstätige MTLA in ihrem Tätigkeitsfeld aufzudecken. Methodisch wurde hier triangulativ vorgegangen, in dem zunächst problemzentrierte, leitfadengestützte Expert*innen-Interviews geführt wurden. Nach deren Auswertung auf Basis der Grounded Theory flossen die Ergebnisse in die Erstellung eines Online-Fragebogens ein. Dieser richtete sich an berufstätige MTLA, die ihren Abschluss in Deutschland absolviert haben.
Der „Generalistik-Diskurs“ im Feld der Pflege im Land Brandenburg
Heidrun Herzberg, Anja Walter, Peter Alheit
Die „Generalistikstudie“ bezieht sich auf eine umfangreiche qualitative Analyse der Diskurse, die sich mit den Auswirkungen des neuen Pflegeberufegesetzes (PflBG) auf die Pflege(bildungs)landschaft im Land Brandenburg auseinandersetzen. Das Gesetz ist seit Januar 2020 in Kraft, und sein Einfluss ist längst spürbar, weil seine Vorgaben beträchtliche Veränderungen des Ausbildungscurriculums der Pflege voraussetzen. Diese Option beeinflusst die anhaltende Pflege(bildungs)reformdiskussion im Lande, deren Profil Gegenstand der hier präsentierten Ergebnisse sein wird. Dabei geht es um „Diskurse“, die diese Reform betreffen. Solche Diskurse lassen sich als einflussreiche „Meinungscluster“ in einem „mentalen Feld“ darstellen. Dazu wurden drei Gruppendiskussionen mit jeweils sechs Schulleiter:innen durchgeführt und insgesamt 19 Expert:inneninterviews mit Vertreter:innen verschiedener Funktionen im Feld der Pflegeausbildung. Ergebnis der Studie ist die Identifikation von vier Bedeutungsclustern:
(1) „Generalistik ohne Bodenhaftung“
(2) „Altenpflege als Opfer“
(3) „Wir brauchen Hilfe“
(4) „Pflege mit Kopf und Hand“
Abstractband 5. Forschungssymposium Physiotherapie
Christian Kopkow
"Forschung fördern, Lehre entwickeln, Versorgung stärken - für die Zukunft der Physiotherapie" war das Motto des 5. Forschungssymposiums Physiotherapie, welches durch die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und die Deutsche Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaft e. V. (DGPTW) am 26. und 27.11.2021 veranstaltet wurde. Im Abstractband des 5. Forschungssymposiums Physiotherapie sind die Abstracts der eingereichten und beim 5. Forschungssymposiums Physiotherapie präsentierten Beiträge veröffentlicht. Zudem sind die veranstalteten Workshops zusammenfassend dargestellt.
„Pflegefachassistenz“ Handlungsempfehlungen für die Anpassung von in Landeszuständigkeit liegenden Ausbildungen in Assistenzberufen in der Pflege als Folge des Pflegeberufereformgesetzes
Anja Walter, Heidrun Herzberg, Peter Alheit
Der vorliegende Forschungsbericht (Kurzfassung) stellt die Ergebnisse einer qualitativen Berufsfeldanalyse zur Situation der ‚Pflegeassistenz‘ im Land Brandenburg vor und präsentiert ein daraus entwickeltes Kompetenzprofil für die zukünftige generalistische Ausbildung von Pflegefachassistent*innen. Empirische Basis der Berufsfeldanalyse sind 44 Expert*inneninterviews sowie 11 teilnehmende Beobachtungen und anschließende Fokusinterviews der beobachteten Personen in verschiedenen Versorgungssettings der Pflege. Sowohl in den Expert*inneninterviews als auch in den teilnehmenden Beobachtungen zeigte sich, dass die Kernkompetenz der Pflegeassistent*innen in der personenzentrierten Grundpflege pflegebedürftiger Menschen gesehen wird. Pflegefachassistent*innen arbeiten eng mit Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern zusammen. Als Kernmerkmale ihrer Tätigkeit haben sich die große (auch körperliche) Nähe, die Häufigkeit der Kontakte und die Kontinuität der Beziehungen zu den zu pflegenden Menschen gezeigt. Vor diesem Hintergrund wird in der Studie der Vorschlag gemacht, zukünftig die Berufsbezeichnung Pflegefachassistent*in anstelle von Pflegehelfer*in zu wählen. Ebenso wird dafür plädiert, dass die Ausbildung von Pflegefachassistent*innen über ein Jahr hinausgehen sollte, damit die Assistent*innen im Anschluss an ihre Ausbildung die Tätigkeiten kompetent ausführen können, die sie in der Regel jetzt schon in der Praxis übernehmen (müssen).
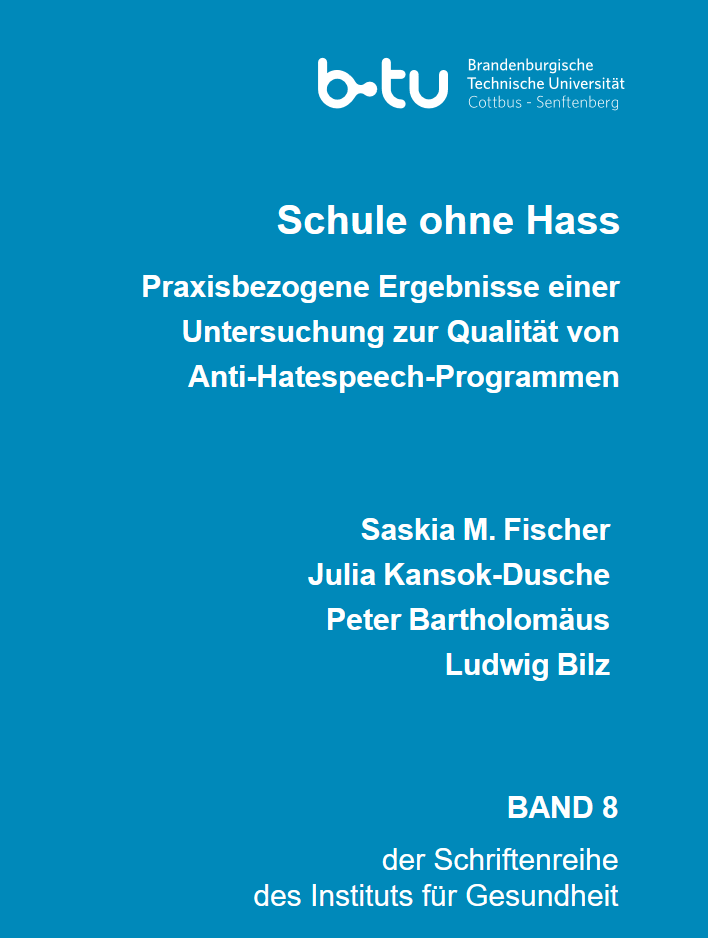
Schulbezogene Anti-Hatespeech-Programme Eine kriteriengeleitete Bestandsaufnahme
Lisanne Seemann-Herz
Das Phänomen Hatespeech gewinnt zunehmend Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und in der Forschung. Das ist insofern wichtig, weil Hass, Hetze und Diskriminierung gegenüber Menschen, die einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden, vor allem über Informations- und Kommunikationstechnologien eine gesamtgesellschaftliche Verrohung zur Folge hat. Hatespeech schränkt die Meinungsvielfalt ein und bedeutet eine Bedrohung für die Demokratie. Sie stellt jedoch kein reines Netzphänomen dar, sondern basiert auf real existierende Macht- und Diskriminierungsstrukturen. Das Phänomen einzudämmen, ist die Intention verschiedener Stiftungen und Initiativen. Hatespeech ist jedoch allgegenwärtig und selbst in der Schule verbreitet. Sie stellt damit eine Gefahr insbesondere für junge Heranwachsende und weiterführend für das alltägliche Schulleben dar. Somit stellt sich die Frage, welche Mittel der Institution Schule zu Verfügung stehen, um dem Phänomen wirksam entgegenzutreten. Im Zuge von präventiven und interventiven Maßnahmen stehen schulbezogene Programme im Vordergrund. Die vorliegende Masterthesis befasst sich daher mit einer ersten Bestandsaufnahme von deutschsprachigen, schulbezogenen Programmen zur Prävention und Intervention bei Hatespeech unter Kindern und Jugendlichen (Jahrgangsstufen 5 bis 12). Insgesamt konnten 14 entsprechende Programme im Rahmen der Recherchearbeit identifiziert werden. Diese wurden auf ihre Inhalte und Durchführungsmodalitäten sowie anhand von fünf ausgewählten Qualitätskriterien analysiert und hinsichtlich ihrer Anwendung in der schulischen Praxis beschrieben und erörtert. Die Übersicht über Schwerpunkte, Stärken sowie Entwicklungspotentiale schulbezogener Hatespeech-Programme soll eine informierte Entscheidung über den Einsatz der Programme in der Schule und darüber hinaus in der offenen Kinder- und Jugendarbeit ermöglichen.
UBICO
Band 7
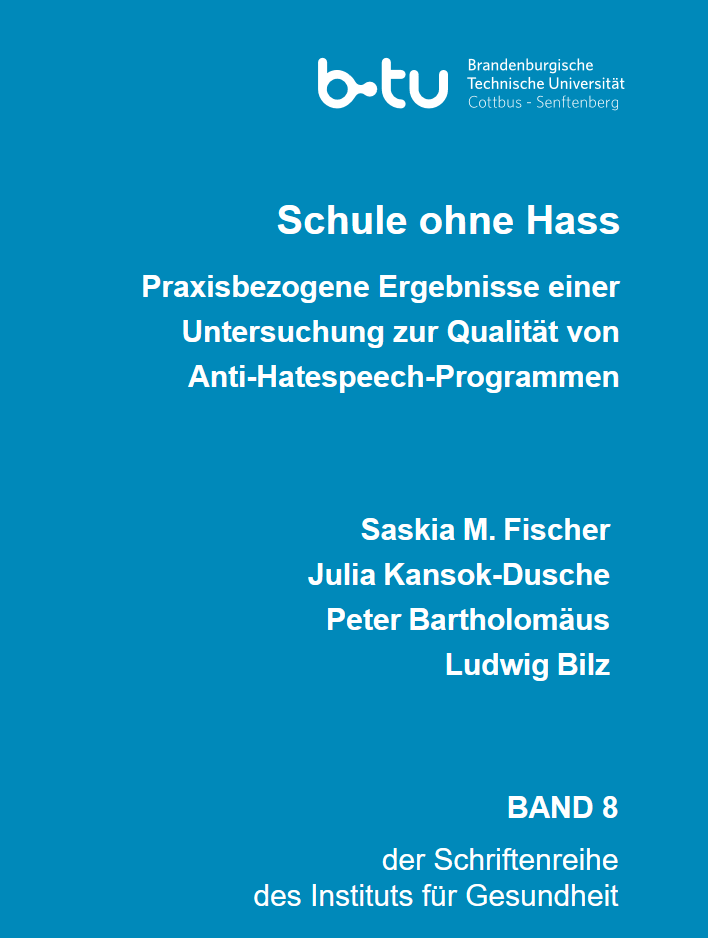
Schule ohne Hass praxisbezogene Ergebnisse einer Untersuchung zur Qualität von Anti-Hatespeech-Programmen
Saskia M. Fischer, Julia Kansock-Dusche, Peter Bartholomäus, Ludwig Bilz
Junge Menschen werden online, aber auch im Schulalltag zunehmend Zeug:innen, Ziel und mitunter auch Ausübende von Hatespeech. Hatespeech ist eine Form menschenfeindlicher Äußerungen und stellt Schulen, zu deren Aufgaben auch Demokratiebildung gehört, vor besondere Herausforderungen. Um Schüler:innen für Hatespeech zu sensibilisieren, sie beim Umgang mit Hatespeech-Situationen zu unterstützen und ihnen erfolgreiche Strategien gegen Hatespeech zu vermitteln, steht eine Vielzahl an Anti-Hatespeech-Programmen zur Verfügung, deren Zielsetzungen, Umfang und Qualität sich stark voneinander unterscheiden. In einer durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ geförderten Studie wurden national und international verfügbare Anti-Hatespeech-Programme ermittelt und einer systematischen Qualitätsanalyse unterzogen. Dabei wurden 16 Qualitätskriterien einbezogen, die sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praxisbezogener Perspektive ermittelt wurden. Insgesamt wurden 27 Anti-Hatespeech-Programme eingeschätzt. In dieser Publikation werden die zentralen Ergebnisse zu den 27 Programmen praxisnah vorgestellt, sodass Praktiker:innen an Schulen eine fundierte Auswahl treffen können. Dazu werden die zentralen Inhalte, Zielgruppen und Kontextbedingungen wie z. B. Dauer, Format und Kosten, aber auch die Ergebnisse der Qualitätseinschätzung für jedes der 27 Programme vorgestellt. Für ausgewählte Situationen und Zielstellungen werden einzelne Programme exemplarisch näher beschrieben. Generelle Empfehlungen für die Auswahl von Programmen inklusive einer Checkliste runden die Publikation für Praktiker:innen ab.
OPUS
Band 8
In der Schriftenreihe des Instituts für Gesundheit werden beispielsweise Projektabschlussberichte, Abstracts und sehr gute Masterarbeiten von Studierenden publiziert. Die Schriftenreihe repräsentiert somit eine der Möglichkeiten der wissenschaftlichen Profilierung des Instituts.
