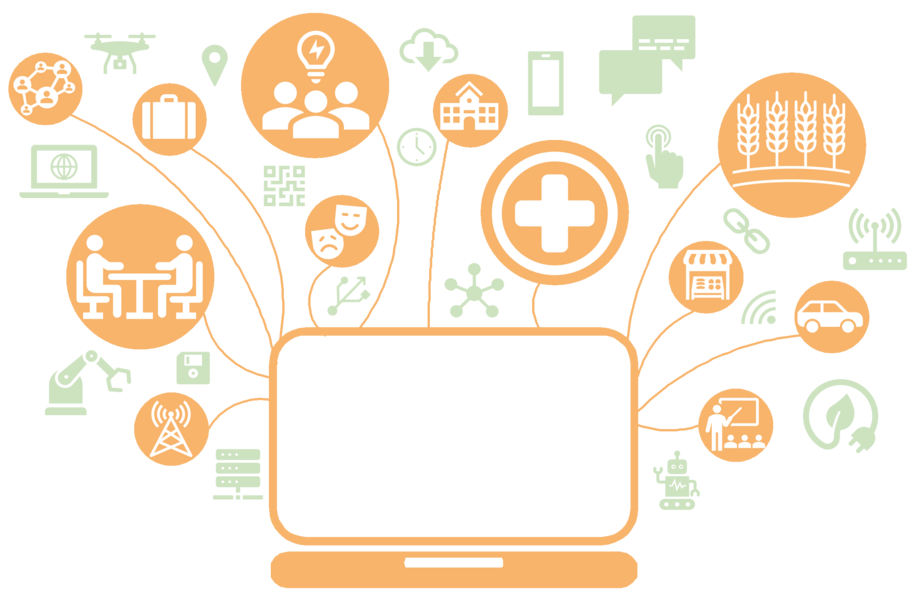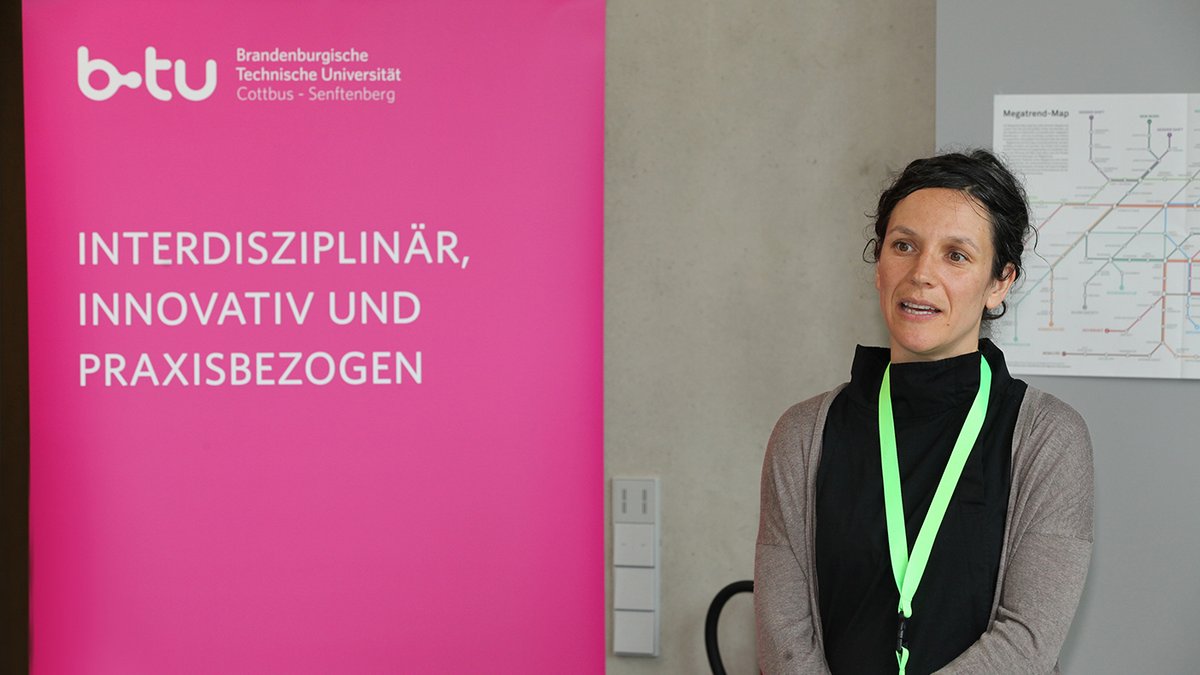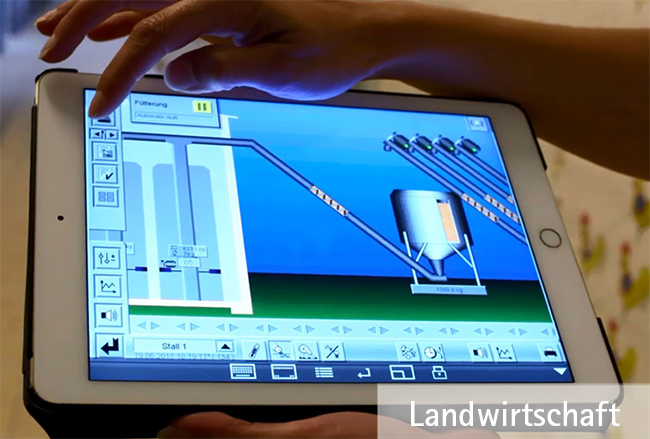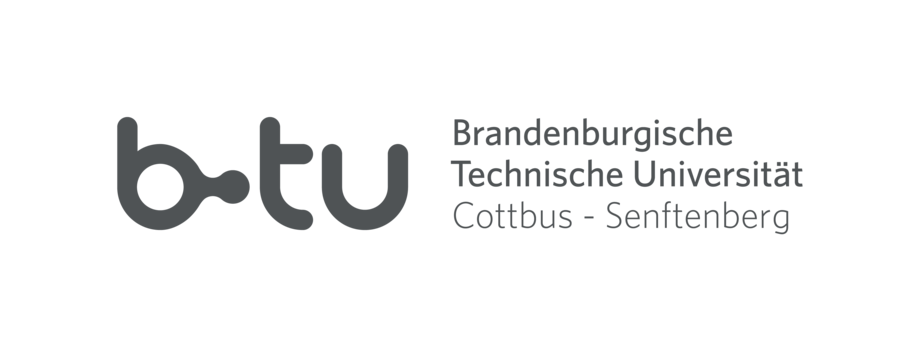

Entwicklungsachse als Transformationsmotor? Forschungen zu regionalen Innovationssystemen mit besonderem Fokus auf den Innovationskorridor Berlin-Lausitz
In Zusammenarbeit mit: Humboldt-Universität zu Berlin, Arbeitsgebiet Angewandte Geographie und Raumplanung
Projektteam: Prof. Dr. Ludger Gailing, Prof. Dr. Henning Nuissl (HU Berlin), Leonard Weiß, Sascha Rentzsch
Förderung: Präsidien der BTU Cottbus-Senftenberg und der Humboldt-Universität zu Berlin
Laufzeit: 10/2023 - 08/2024
Im Rahmen einer wissenschaftlichen Kooperation befassten sich das Fachgebiet Regionalplanung der BTU Cottbus-Senftenberg und der Arbeitsbereich Angewandte Geographie und Raumplanung der HU Berlin gemeinsam mit dem Ansatz der regionalen Entwicklungsachse. Im Zentrum des Interesses stand dabei die Frage, ob und wie Achsenkonzepte für die regionale Entwicklung nutzbar gemacht werden können – mit besonderem Fokus auf Zukunftsaussichten für den Innovationskorridor Berlin-Lausitz.
Im Zuge der Auseinandersetzungen entstand ein Gutachten, das auf Basis einer Literaturanalyse die Geschichte von Achsenkonzepten, verschiedene Interpretationsansätze sowie Befunde zu den Effekten aufführt und ein Gutachten, was sich mittels einer Delphi-Befragung mit den Perspektiven, Herausforderungen und zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten für das Vorhaben Innovationskorridor Berlin-Lausitz auseinandersetzt. In einem ersten Workshop im März in Berlin wurden räumliche, thematische und strategische Facetten der Nutzung von Achsenkonzepten im Rahmen von Förder-, Cluster- und Ansiedelungspolitiken erkundet und für den Korridor Berlin-Lausitz konkretisiert. Ein zweiter Workshop fand am 24. Juni 2024 in Cottbus statt und bot die Möglichkeit zum Austausch über Standortfaktoren und Innovationsfelder im Rahmen des Transformationsprozesses sowie zur Vernetzung und zum Einbezug unterschiedlicher Teilräume und Stakeholder entlang des Innovationskorridors Berlin-Lausitz.

Aktuelles aus dem Projekt
Gutachten zu Ergebnissen einer Delphi-Studie zum Innovationskorridor Berlin-Lausitz
Januar 2025
In der Schriftenreihe Transform des Instituts für Stadtplanung der BTU Cottbus-Senftenberg ist ein im Rahmen der Forschungskooperation entstandenes Gutachten erschienen. Darin untersucht Leonard Weiß Impulse, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren bei der Entwicklung des Innovationskorridors Berlin-Lausitz mittels einer Delphi-Studie.
Studie zum Konzept der raumordnerischen Achse mit Bezug zum regionalen Innovationsgeschehen
Oktober 2024
Projektbegleitend ist in der Schriftenreihe ARBEITSBERICHTE des Geographischen Instituts der HU Berlin eine erste Publikation mit dem Titel "Innovationskorridor als Transformationsmotor?" erschienen. In dieser widmet sich Sascha Rentzsch aus dem Projektteam der Diskussion um das Konzept der raumordnerischen Achse in Bezug zum regionalen Innovationsgeschehen.
Verbundprojekt Cross-InnoNet: Grenzüberschreitende Daseinsvorsorge Berlin-Szczecin. Governance-Netzwerk in den Bereichen Gesundheit und Mobilität entlang der ausgebauten Zugstrecke Teilvorhaben 1: CrossInnoGov: Governance und Vernetzung in der grenzüberschreitenden Daseinsvorsorge

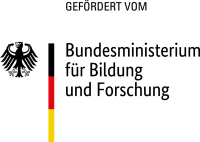
Strategische Verbundvorhabenkoordination: Dr. Peter Ulrich
Projektteam: Prof. Dr. Ludger Gailing (Projektleitung an der BTU), Leonard Weiß und Martin Reents
Verbundpartner:Deutsches Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung (DIFA)
Regionale Kooperationspartner: DB Regio AG (Regio Nordost), Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), Arbeitsgemeinschaft UCKER Warentakt (Uckermärkische Verkehrsgesellschaft UVG & HNEE), Universität Potsdam (Kommunalwissenschaftliches Institut), Universität Szczecin (Institute of Spatial Management and Socio-Economic Geography)
Förderorganisation: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Fördermaßnahme „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“, WIR!-Bündnis „region4.0“ (koordiniert an der HNEE)
Regionales Innovationscluster: WIR!-Bündnis „region4.0“ (koordiniert an der HNEE) für die Region Barnim-Uckermark im Nordosten Brandenburgs
Laufzeit: 09/2022 - 03/2025




Das Verbundvorhaben „Cross-InnoNet“ untersuchte und erprobte, wie grenz- und sektorenübergreifende Daseinsvorsorge in der ländlich geprägten Region entlang der bis 2026 modernisierten Bahnstrecke zwischen den Metropolregionen Berlin und Stettin gestärkt werden kann. Dabei standen die Bereiche Gesundheit und Mobilität, die Vernetzung von Akteuren und der synergetische Einbezug von grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Netzwerken im Fokus.
Der Ausbau dieser Bahnstrecke wurde im Rahmen des Projekts als Innovationsimpuls verstanden, um die dazwischen befindliche Region mit wenigen Mittelstädten und ländlichen Gemeinden entlang der Bahnknotenpunkte zu stärken und Perspektiven für eine nahverkehrsorientierte Regionalentwicklung aufzuzeigen. In der dünn besiedelten, peripheren und strukturschwachen Region sollte durch das Projekt die nachhaltige Erreichbarkeit gestärkt und die Daseinsvorsorgeakteure und -dienstleistungen auch grenzübergreifend vernetzt und so Grundsteine für eine In-Wertsetzung der Bahnkorridorachse gelegt werden.
Dafür wurde eine Analyse von grenz- und sektorenübergreifenden Netzwerken in den Daseinsvorsorgebereichen Mobilität und Gesundheit durchgeführt, um Zugänglichkeit, Hürden und Perspektiven von Kooperationen zu untersuchen. Außerdem wurden am Fachgebiet Regionalplanung Forschungen zum Mobilitätsverhalten entlang der Bahnstrecke sowie im Stationsumfeld durchgeführt und in einer Studie Potentiale der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung aufgeführt. Die Ergebnisse sind Teil von partizipativen Formaten mit Akteuren in der Untersuchungsregion und die Grundlage für einen „Service-Fahrplan“, der Empfehlungen zur Governance und Raumentwicklung, der verbesserten Erreichbarkeit und neuen Kooperationen im Zusammenhang mit der Nutzbarmachung der Potentiale durch den Streckenausbau skizziert.
Das Verbundvorhaben wurde vom Fachgebiet Regionalplanung der BTU koordiniert und gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung (DIFA) durchgeführt. Das Verbundvorhaben bestand aus zwei Teilprojekten – aus dem Teilvorhaben 1 „Cross-InnoGov: Governance und Vernetzung in der grenzüberschreitenden Daseinsvorsorge“ der BTU Cottbus-Senftenberg und Teilvorhaben 2 „Versorgungsatlas und Liniennetz gesundheitlicher, ambulanter und fachärztlicher Versorgung in der ‚region4.0‘“ des DIFA.

Nachrichten aus dem Projekt
Mobilitätsstudie & Strategiebausteine einer nahverkehrsorientierten Regionalentwicklung
31. März 2025
Nach zweieinhalb Jahren intensiver Projektarbeit freuen wir uns, zwei zentrale Ergebnisse zu veröffentlichen: eine Studie zum Mobilitätsverhalten, basierend auf Erhebungen im Winter 2023/24 während des Streckenausbaus zwischen Angermünde und Szczecin sowie den „Service-Fahrplan“ als zweigeteiltes Abschlussdokument, das Perspektiven auf die Verbindung von öffentlicher Mobilität mit Gesundheitsversorgung in der deutsch-polnischen Grenzregion zusammenführt und Handlungsmöglichkeiten für eine nahverkehrsorientierte Regionalentwicklung aufzeigt.
Deutsch-polnische Konferenz „In 90 Minuten von Berlin nach Szczecin“
4. bis 5. März 2025
Die Bahnstrecke Berlin-Szczecin wird eine schnellere Verbindung zwischen den beiden Städten ermöglichen. Die sich abzeichnenden Veränderungsdynamiken in der Verflechtungsregion entlang der Strecke thematisierte eine zweitägige, deutsch-polnische Konferenz in Szczecin – mit Beiträgen aus der Praxis zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wirkungen des Streckenausbaus. Weitere Informationen finden Sie hier, eine ausführliche, deutsch-polnische Dokumentation ist hier abrufbar.
Studie zu Verflechtungen und Potenzialen in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung
2. August 2024
Die erschienene Studie „Analyse der grenzüberschreitenden Daseinsvorsorge und Skizzierung von Zukunftspotenzialen“ ist das Ergebnis der Untersuchung von rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und der Analyse der Versorgungslage im Grenzraum zwischen Eberswalde und der Metropolregion Szczecin. Sie baut auf einer Zukunftswerkstatt im Januar 2024 auf, bei der mit Akteuren aus beiden Ländern zu Perspektiven der deutsch-polnischen Gesundheitslandschaft diskutiert wurde. Die Studie wurde von INFRASTRUKTUR & UMWELT in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Regionalplanung erstellt und ist unter diesem Link abrufbar.
Abschlusskonferenz „Ab in die Zu(g)kunft“
19. Juni 2024
Nach fast zweijähriger „Cross-InnoNet“-Projektarbeit zu Fragen der Regionalentwicklung entlang der Achse Berlin-Eberswalde-Angermünde-Szczecin wurden am 19. Juni die Ergebnisse an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde präsentierten. Die rund 60 Gäste der zweisprachigen Konferenz diskutierten die Impulse des Schienenausbaus und die Potenziale für eine gestärkte Daseinsvorsorge zwischen den Bereichen Mobilität und Gesundheit und im deutsch-polnischen Verflechtungsraum. Die Dokumentation der Veranstaltung ist hier abrufbar.
Online-Workshop zu Bahnhofsumfeldentwicklung
21. Mai 2024
Wie können Bahnhöfe in ländlichen Regionen zur Daseinsvorsorge und Mobilitätswende beitragen? Dieser Frage widmete sich ein gemeinsamer Online-Workshop der Projekte ISDN - Integrierte Strategie für Daseinsvorsorge und Nachhaltigkeit in ländlichen Räumen (Universität Kassel) und Cross-InnoNet (BTU Cottbus-Senftenberg) mit Beispielen aus Gößnitz (Ostthüringen) und Angermünde (Uckermark). Eine ausführliche Zusammenfassung des Workshops steht hier zum Download bereit.
Zukunftswerkstatt: Vernetzte Daseinsvorsorge
18. April 2024
Dass das Nachdenken über knifflige Themen auch ausgetretene Wege verlassen kann, konnten die Teilnehmer*innen im April in Angermünde erleben. Mit der Design-Thinking-Methode wurde etwa über die Kombination von bestehenden Lösungen zu einem „Zentaur“ – mit der Intelligenz des Menschen und der Geschwindigkeit des Pferdes – gegrübelt. Herausgekommen sind Ansätze, wie zum Beispiel digitale Dorfkümmerer:innen, die schlecht erreichbare Termine mit den Fahrtrouten und Auslastungen von Pflegediensten und Dialysefahrten abgleichen und Reisemöglichkeiten vermitteln könnten und die im Projekt weiterbearbeitet werden.
Zukunftswerkstatt: Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung
31. Januar 2024
Wie funktioniert Gesundheitsversorgung beiderseits der Grenze? Wo kann grenzüberschreitende Zusammenarbeit die Versorgungssituation verbessern und welche Herausforderungen sind dafür zu lösen? Diese Leitfragen standen im Zentrum der zweiten Zukunftswerkstatt im Projekt. Die Teilnehmer:innen aus Deutschland und Polen tauschten sich dazu aus, wie sie sich die Gesundheitsversorgung im Jahr 2030 in der deutsch-polnischen Verflechtungsregion vorstellen. Im Anschluss daran wurde diskutiert, welche Herausforderungen zu bewältigen sind, um eine den Wünschen entsprechende Versorgung realisieren zu können.
Umfrage zum Verkehrsverhalten in Nordostbrandenburg gestartet
1. November 2023
„Was bewegt denn dich?“ fragen wir die Menschen im Barnim, der Uckermark und der Metropolregion Stettin in einer Umfrage zum Mobilitätsverhalten. Darin wollen wir Erkenntnisse zur Verkehrsmittelwahl, der Zufriedenheit und den Bedürfnissen in Bus und Bahn zwischen Berlin und Stettin gewinnen. Die Umfrage läuft bis zum 31. Dezember 2023 und ist in deutscher und polnischer Sprache verfügbar.
Cross-InnoNet auf dem Deutschen Kongress für Geographie
20. September 2023
Unter dem Titel „Die Entwicklung der Bahnachse Berlin–Szczecin als Impuls zur nachhaltigen, grenzüberschreitenden Entwicklung im ländlichen, deutsch-polnischen Verflechtungsraum“ präsentierten Sunna Kovanen und Leonard Weiß in Frankfurt am Main Ergebnisse der Netzwerkanalyse zur grenz- und sektorenübergreifenden Daseinsvorsorge. Der Vortrag war Teil einer DKG-Session, die den Tagungstitel „Sustainable Futures?!“ mit Bezug zu nachhaltiger Entwicklung auf regionaler und kommunaler Ebene diskutierte.
Zukunftswerkstatt Mobilität & Gesundheit: Innovative Versorgung in ländlichen Räumen – mobile medizinische Angebote und Infrastrukturen
8. Juni 2023
Welche Herausforderungen, Lösungsansätze und Umsetzungsschwierigkeiten gibt es bei der Verknüpfung von Gesundheitsangeboten und Mobilität in ländlichen Räumen? Unter dieser Leitfrage diskutierten an einem sonnigen Donnerstag im Haus mit Zukunft in Angermünde Akteur:innen aus Praxis, Verwaltung und Politik. Die Ziele der Zukunftswerkstatt „Mobilität & Gesundheit“ waren die Vernetzung von Beteiligten mit verschiedenen Hintergründen und deren Herausforderungen sowie die Entwicklung eines geteilten Verständnisses über die Barrieren, die verhindern, dass bestehende Dienstleistungen erhalten bleiben oder neue, mobile und digitale Angebote entstehen.
Planspiel „Innovative Versorgung und Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen. Das Beispiel Apothekenversorgung im Landkreis Uckermark"
25. bis 26. Mai 2023
Auf Einladung des Landkreises Uckermark und der Gemeinde Boitzenburger Land waren Studierende der Universität Potsdam und der HNE Eberswalde zu Gast in Boitzenburg. Zum Thema „Apothekenversorgung in ländlichen Räumen“ wurde vom Kommunalwissenschaftlichen Institut der Universität Potsdam in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Regionalplanung der BTU Cottbus-Senftenberg ein Planspiel organisiert. Darin schlüpften die Studierenden in die Rollen von verschiedenen Handelnden, die an einer Lösungsfindung für die geschlossene Apotheke in Boitzenburg beteiligt sein könnten. Für die Spielzeit wurden sie so beispielsweise zum Gemeindeoberhaupt, zur Vertretung des Landkreises, der Apothekerkammer oder der Verkehrsbetriebe, um die Problemlage lokaler Daseinsvorsorge zu verstehen, Handlungsspielräume der Beteiligten kennenzulernen und Lösungsideen zu entwickeln.

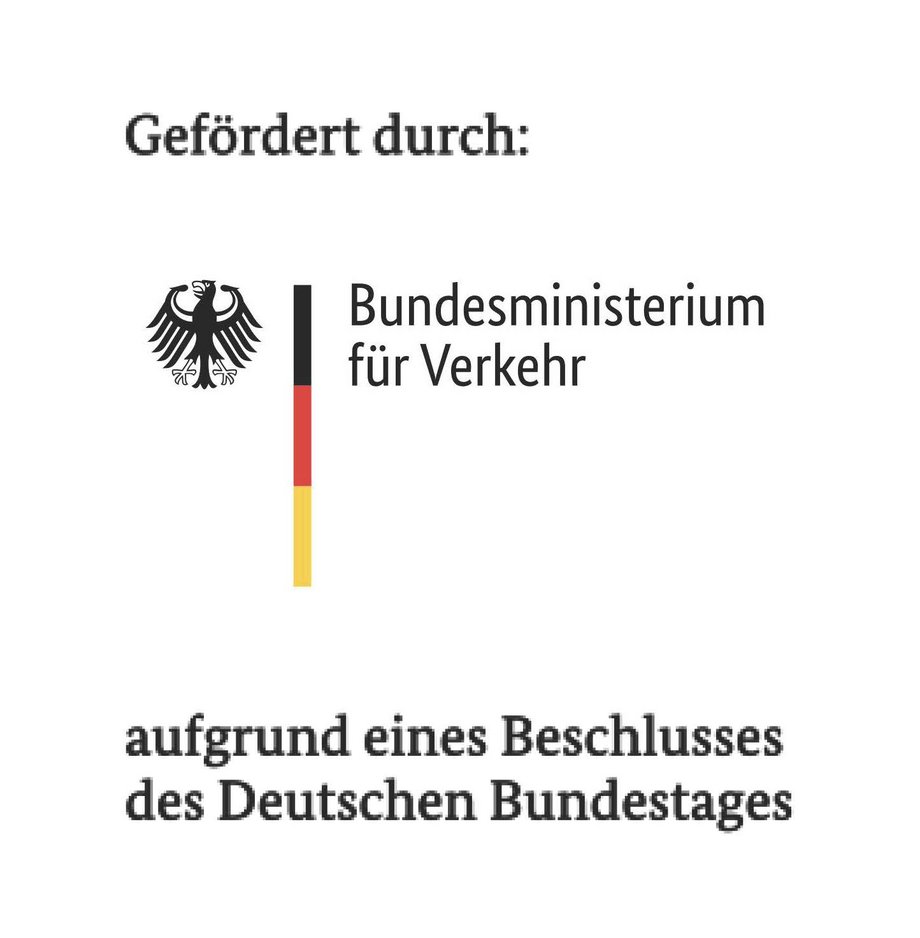
Mobilitätsunterstützung mittels datenbasierter Verkehrslenkung sowie alternativer Angebote für die touristische Mobilität in der Lausitz (MoVeToLausitz)
Projektleitung am Fachgebiet: Prof. Dr. Ludger Gailing
Projektteam: Jan Nowakowski, Henk Wiechers
Verbundpartner: [ui!] Urban Mobility Innovations (B2M Software GmbH) (Koordination), Urban Software Institute GmbH, Fachgebiet Dekarbonisierung und Transformation der Industrie (BTU), Fachgebiet Diskrete Mathematik und Grundlagen der Informatik (BTU), Fraunhofer IVI, Fraunhofer IML (Projektzentrum Verkehr, Mobilität und Umwelt), RBO Regionalbus Ostbayern GmbH
Förderorganisation: Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), Innovationsinitiative mFUND
Laufzeit: 07/2022 - 11/2025
Link zur Projektseite: http://www.movetolausitz.de/
Link zur Fördermaßnahme: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/mfund-projekte/movetolausitz.html
Im Rahmen des Verbundprojektes MoVeToLausitz war es das Ziel unseres Fachgebietes, den Transformationserfordernissen des Klimawandels und einer damit eng verknüpften Verkehrswende im regionalen Kontext touristischer Mobilität nachzugehen. Dies erfolgte zum einen durch die Analyse der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von bestehenden Verkehrs- und Tourismuskonzepten und deren Verschränkungen zu anderen Sektoren im Kontext nachhaltiger Regionalentwicklung. Diese Kontextualisierungen wurden verknüpft mit partizipativen und kooperativen Methoden der qualitativen Sozialforschung. In Expert*innengesprächen mit Stakeholdern, Bewohner*innen und Tourist*innen wurden qualitativ lokale Mobilitätsbedarfe erhoben und in Fokusgruppen kooperativ Zukunftsszenarien und Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige touristische Mobilität in der Lausitz entwickelt.
Das Forschungsprojekt MoVeToLausitz wurde durch die Innovationsinitiative mFUND des BMDV gefördert. Das übergeordnete Ziel bestand darin, nachhaltige Perspektiven und Potenziale digitaler Verkehrstechnologien im Bereich der Freizeit- und Tourismusmobilität in Verknüpfung mit der Alltagsmobilität im ländlichen Raum aufzuzeigen. Dabei sollte die Entwicklung eines Konzepts im Zentrum stehen, welches Attraktivität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit des Tourismus des Lausitzer Reviers in Kombination betrachtet und in diesem Zusammenhang die Potenziale intelligenter, intermodaler, grenzübergreifender und bedarfsgetriebener Mobilitätslösungen untersucht. Insgesamt wird eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs in der Region angestrebt.

Nachrichten aus dem Projekt
Abschlussveranstaltung von MoVeToLausitz
23. September 2025
Nach über drei Jahren Projektlaufzeit fand am 23. September 2025 die digitale Abschlussveranstaltung Forschungsprojekts „MoVeTo Lausitz” statt. Im Mittelpunkt standen die Präsentation und Diskussion der Forschungsergebnisse aus insgesamt zwölf Arbeitspaketen. Das Fachgebiet Regionalplanung war federführend an der Bearbeitung zweier Arbeitspakete beteiligt.
Das Fachgebiet befasste sich unter anderem mit dem Tourismus in der Lausitz, insbesondere in den beiden Projektregionen Lausitzer Seenland und Spreewald. Neben der Identifizierung der Untersuchungsregionen wurden Handlungsansätze für eine nachhaltige touristische Mobilität analysiert. Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines Working Papers verschriftlicht. Darüber hinaus wurden das Mobilitätsverhalten und die Mobilitätsbedarfe von Übernachtungs- und Tagestouristen in Burg (Spreewald) und Senftenberg (Lausitzer Seenland) untersucht. Aus der Perspektive der Einheimischen wurde analysiert, welche Chancen und Herausforderungen On-Demand-Verkehre in der Alltagsmobilität für die soziale Teilhabe bieten.
Im Rahmen der Abschlussveranstaltung wurde außerdem der „Wegweiser Lausitz On-Demand“ vorgestellt, an dessen Erstellung das Fachgebiet beteiligt war. Der Wegweiser bietet für Kommunen, Landkreise und politische Entscheidungsträger*innen eine praxisorientierte Einführung in Planung und Umsetzung moderner Bedarfsverkehre. Er beschreibt grundlegende Schritte von der Analyse und Konzeption bis hin zu organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen und zeigt anhand von Beispielen aus der Lausitz, wie On-Demand-Angebote den bestehenden Linienverkehr sinnvoll ergänzen können, etwa bei der Anbindung touristischer Points of Interest oder der Verbesserung der Erreichbarkeit von Orten des täglichen Bedarfs.
Der Wegweiser kann hier heruntergeladen werden.
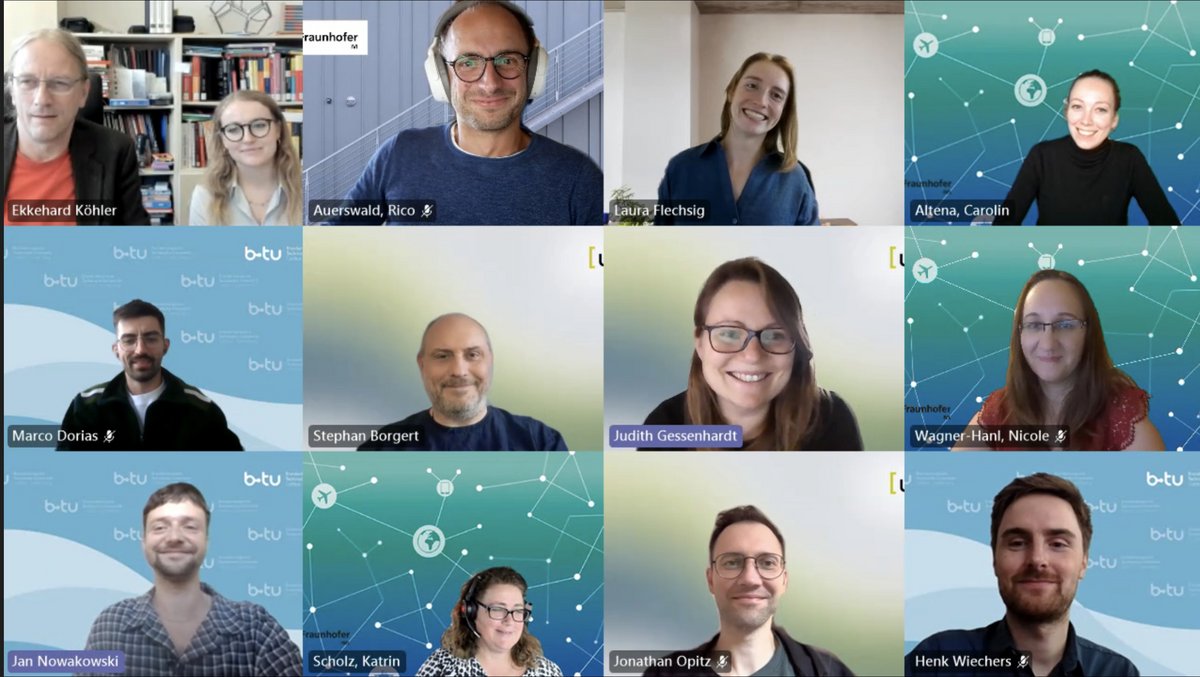

5. Konsortialtreffen in Dresden
8.-9. April 2025
Zum letzten Konsortialtreffen kam das Team im April 2025 beim Fraunhofer IVI in Dresden zusammen. Im Mittelpunkt standen die finalen Angelegenheiten im Projektverlauf, insbesondere in Bezug auf die Evaluation im August 2025. Auch die gemeinsame Publikationsstrategie wurde intensiv besprochen.
Ein weiterer Programmpunkt bestand aus einem geführten Rundgang durch die Dresdner Altstadt, organisiert von unserem Projektkollegen Rico Auerswald. Die Stadtführung bot nicht nur interessante historische Einblicke, sondern ermöglichte auch einen informellen Austausch.
4. Konsortialtreffen in Prien am Chiemsee
15.-16. Oktober 2024
Im Oktober traf sich das MoVeTo Lausitz-Team am Fraunhofer IML im Projektzentrum »Verkehr, Mobilität und Umwelt« in Prien am Chiemsee, um alternative Mobilitätsformen zu besprechen und spannende Einblicke in die touristische Mobilität der Chiemsee-Region zu erhalten. Unter anderem stellte Dietmar Bauer von der Regionalverkehr Oberbayern GmbH den On-Demand-Dienst „Rosi“ vor, welcher bei einer anschließenden Exkursion getestet wurde. Ein weiteres Highlight war die Erkundung anderer alternativer Mobilitätsformen wie Carsharing, Mitfahrbänke und dem ÖPNV in der Region. Abgerundet wurde das Treffen durch eine Schifffahrt auf dem Chiemsee.


3. Konsortialtreffen in Senftenberg
24.-25. April 2024
Beim dritten Projekttreffen, am Campus Senftenberg der BTU, lag der Fokus auf dem Lausitzer Seenland. Im Gegensatz zur etablierten Tourismusregion Spreewald im nördlicheren Teil des Untersuchungsgebietes ist hier im Zuge des Strukturwandels noch vieles im Entstehungsprozess. Mittels einer Fahrradtour wurden erste Impulse durch das Projekt festgestellt und die Region rund um den Senftenberger See erkundet. Besonders spannend waren die POIs (Points of Interest), wie der „Rostige Nagel“. Dabei waren auch die beiden Tourismusverbände Lausitzer Seenland und Spreewald.
Ergänzend fanden Workshops und Updates - auch mit unseren assoziierten Partnern - statt.



2. Konsortialtreffen in Cottbus und Burg (Spreewald)
22.-23. Mai 2023
Nach der Auftaktveranstaltung und dem ersten Konsortialtreffen im September 2022 kam das MoVeTo Lausitz-Team zum zweiten Treffen zusammen. Im IKMZ der BTU Cottbus-Senftenberg standen am ersten Tag die anstehenden Arbeitspakete sowie die weitere Projektplanung im Fokus.
Am nächsten Tag ging es nach Burg (Spreewald), einem der touristischen Hotspots in der zweiten Untersuchungsregion. Die Wahl fiel bewusst auf Burg, da die Gemeinde mit erheblichen Verkehrsproblemen konfrontiert ist. So stellt die Überlagerung von Wirtschaftsverkehr, Alltagsmobilität und touristischem Verkehr eine besondere Herausforderung dar. Zudem ist Burg nicht an das Netz des Schienenpersonennahverkehrs angebunden.
Vor Ort wurden im Rahmen einer Radtour zentrale Orte und Mobilitätsherausforderungen durch Frau Stephan vom Amt Burg veranschaulicht.
Das Forschungsprojekt MoVeToLausitz wurde als "Beispiel aus der Praxis" in Mobilikon, das Online-Nachschlagewerk des BBSR zu Mobilitätsthemen, aufgenommen.
Mehr Informationen dazu hier.
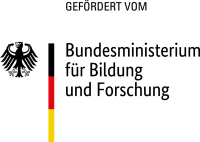


Integrative Entwicklung eines gerechten Interessenausgleichs zwischen Stadt, städtischem Umland und ländlichem Raum (ReGerecht)
Projektleitung an der BTU: Prof. Dr. Ludger Gailing
Projektteam: Eva Eichenauer, Kamil Bembnista, Leonard Weiß, Sascha Rentzsch
Verbundpartner: Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH für die ILS Research gGmbH (Koordination), Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Koordination), CODIP TU Dresden (Center for Open Digital Innovation and Participation), Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), Landeshauptstadt Schwerin, Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg, Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH
Förderorganisation: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Laufzeit: 09/2018 - 03/2025
Link zur Projektseite: https://regerecht.de
Link zur Fördermaßnahme: https://www.zukunftsstadt-stadtlandplus.de/
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Fördermaßnahme Stadt-Land-Plus der Leitinitiative Zukunftsstadt geförderte Verbundprojekt ReGerecht setzt sich zum Ziel, Lösungen für einen gerechten Interessenausgleich zwischen Stadt, städtischem Umland und ländlichem Raum zu erarbeiten und zu implementieren. Regionaler Schwerpunkt sind die Forschungsregionen Westmecklenburg und Cottbus/Landkreis Spree-Neiße. Mit dem Verbundprojekt werden zwei zentrale Fragen beantwortet: Wie entstehen regionale Nutzungskonflikte? Und: Wie lassen sich gerechte Lösungen für diese Nutzungskonflikte finden?
Das Teilprojekt der BTU beleuchtet Fragen der Gerechtigkeit und räumlicher Verflechtungen im Kontext der Energiewende. Dabei werden unter anderem der Ausbau erneuerbarer Energien und Gesetze zur finanziellen Beteiligung, die Strukturwandelförderung in der brandenburgischen Lausitz und räumliche Verflechtungen im deutsch-polnischen Grenzraum untersucht. Das Teilprojekt verortet sich in internationalen Debatten z.B. um „energy justice“, „spatial justice“ und „border studies“.

Nachrichten aus dem Projekt
April 2024: Eva Eichenauer beim IRS Regionalgespräch
Am 24.April 2024 nahm Eva Eichenauer am IRS Regionalgespräch zum Thema „Von Tesla lernen? Planung zwischen Beschleunigung und Beteiligung“ teil. Dort präsentierte sie Ergebnisse aus ihren Forschungen zu Planungskonflikten beim Ausbau von Windenergie und möglichen Ansätzen einer konstruktiven Bearbeitung von Planungskonflikten.
Dezember 2023: Publikation zum Thema "Mehr Akzeptanz durch verpflichtende finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen. Die Handlungsebene der Bundesländer"
Unter dem Titel "Mehr Akzeptanz durch verpflichtende finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen. Die Handlungsebene der Bundesländer" haben Eva Eichenauer und Prof. Dr. Ludger Gailing vom Fachgebiet Regionalplanung der BTU Cottbus-Senftenberg ein neues Working Paper zur verpflichtenden finanziellen Beteiligung an Windenergieanlagen veröffentlicht. Auf Ebene verschiedener Bundesländer untersuchen sie bereits etablierte Gesetze und die damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die lokale Akzeptanz in Kommunen.
Das Working Paper ist die erste Publikation in der neuen Schriftenreihe "Transform" des Instituts für Stadtplanung, die sich mit Themen der Stadt- und Regionalplanung rund um die Große Transformation beschäftigen wird.
Weitere Informationen und den Download (Open Access) finden Sie auf der folgenden Website: https://opus4.kobv.de/opus4-btu/frontdoor/index/index/docId/6486
Oktober 2023: Ludger Gailing als Sachverständiger zum Bürgerenergiegesetz NRW im Landtag
Am 31. Oktober 2023 fand im Düsseldorfer Landtag eine Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zum geplanten Bürgerenergiegesetz Nordrhein-Westfalen statt. Prof. Dr. Ludger Gailing nahm hieran als Sachverständiger teil und konnte auf der Grundlage der Forschungsergebnisse des BTU-Teilprojekts von ReGerecht Erfahrungen aus der verpflichtenden Beteiligung von Kommunen sowie von Bürgerinnen und Bürgern an der Windenergienutzung in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg einbringen.
August 2023: Abschlussveranstaltung des Projektes ReGerecht
Am 28.August 2023 fand in Schwerin die Abschlussveranstaltung des Projektes „ReGerecht - Integrative Entwicklung eines gerechten Interessenausgleichs zwischen Stadt, städtischem Umland und ländlichem Raum“ statt. In dem über fünf Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbundvorhaben beschäftigten sich die Wissenschaftler*innen des Fachgebietes Regionalplanung mit Gerechtigkeitsfragen bei der Umsetzung der Energiewende. Empirisch im Fokus standen die Analyse finanzieller Beteiligung an Windenergieanlagen und die Vergabe der Strukturwandelfördermittel in der Brandenburger Lausitz.
Das transdisziplinäre Verbundvorhaben wurde unter der Leitung des Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) gemeinsam mit Kolleg*innen des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), der Technischen Universität Dresden, Center for Open Digital Innovation and Participation (CODIP), der Landeshauptstadt Schwerin, Fachdienst Stadtentwicklung und Wirtschaft, des Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg, sowie der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH umgesetzt.
August 2023: Paper zu Planungskonflikten und Gerechtigkeit veröffentlicht
Unter dem Titel „Planungskonflikte und Gerechtigkeit: Konzeptionelle Überlegungen am Beispiel des Ausbaus der Windenergie im Nordosten Deutschlands“ verfasste unsere akademische Mitarbeiterin Eva Eichenauer eine wissenschaftliche Publikation, die in der Zeitschrift „Raumforschung und Raumordnung“ veröffentlich wurde. Aufbauend auf den Forschungen im Projekt ReGerecht (LINK) wurden hier Konflikte um den Ausbau von Windkraftanlagen aus einer gerechtigkeitstheoretischen Perspektive analysiert und für eine stärkere Verknüpfung von Konflikt- und Gerechtigkeitstheorien argumentiert.
Der Beitrag kann kostenfrei hier heruntergeladen werden: https://rur.oekom.de/index.php/rur/article/view/1681
Juni 2023: Gutachten zur finanziellen Beteiligung an Windenergieanlagen veröffentlicht
Untersuchung von Chancen und Risiken einer finanziellen Teilhabe bei Erneuerbare-Energien-Anlagen
Im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft haben Eva Eichenauer und Prof. Dr. Ludger Gailing ein Gutachten zu finanzieller Beteiligung an Windenergieanlagen erstellt. Darin untersuchen sie Chancen und Risiken einer verpflichtenden Landesregelung für den Freistaat Sachsen. Dazu wurden die bestehenden Gesetzgebungen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, in denen bereits eine Pflicht zur Beteiligung besteht, sowie die ersten Erfahrungen mit der Umsetzung der freiwilligen Beteiligungsmöglichkeit nach EEG analysiert. Die Autor:innen kommen zu dem Schluss, dass eine verpflichtende Landesregelung und garantierte lokale Wertschöpfung die Akzeptanz für erneuerbaren Energien signifikant steigern und damit auch den notwendigen Ausbau beschleunigen kann.
Das Gutachten kann auf der Seite des Staatsministeriums unter https://www.energie.sachsen.de/akzeptanz-und-beteiligungsmanagement-4493.html heruntergeladen werden.
Am 21.03.2023 fand der Workshop zu Klimaschutz und Klimaanpassung im Stadt-Umland-Kontext in der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. in Berlin statt. Aufbauend auf drei Inputvorträge traten die Referent*innen und Teilnehmer*innen aus Landes- und Kommunalinstitutionen sowie aus der Forschung in einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch.
Mehr zur Veranstaltung hier.
Im Rahmen der BTU internen Online-Reihe „15 Minuten Forschung“ hielt Prof. Dr. Ludger Gailing einen Vortrag, in dem er theoretische wie empirische Ergebnisse des Forschungsprojekts ReGerecht präsentierte. Unter dem Titel „Gerechte Energiewende? – Erkenntnisse aus der regionalen Forschung“ betonte er die zentrale Rolle von Gerechtigkeit für regionale Transformationsprozesse. Ein Thema, welches insbesondere für die Lausitz von höchster Relevanz ist.
Veranstalter: Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Präsidium. 16.11.2022, Cottbus.
Im Oktober führte der Weg von Eva Eichenauer nach Saarbrücken, um dort im Rahmen einer Vortragsreihe anlässlich des Jubiläums „700 Jahre Saarbrücker Freiheit“ einen Vortrag zu den teils konflikthaften Beziehungen von Stadt und Land zu halten. Sie ging der Frage nach, ob das, was Menschen auf dem Land suchen, nicht auch in Städten umsetzbar sei und rekurrierte dabei auf Aspekte partizipativer nachhaltiger Stadtentwicklung und gerechter Planung.
Der Artikel What Triggers Protest? – Understanding Local Conflict Dynamics in Renewable Energy Development wurde in einem Special Issue “Land Use and Land Use Conflicts in the Context of Energy Production, Conservation and Sustainable Development” (Hrsg. Prof. Dr. Deborah Shmueli und Prof. Dr. Olaf Kühne) der Zeitschrift LAND veröffentlicht. Eva Eichenauer und Prof. Dr. Ludger Gailing analysieren hier Konfliktbedingungen bei lokalen Konflikten um den Ausbau von Windkraftanlagen. Sie argumentieren, dass bestimmte Konflitkonstellationen konstruktive Konfliktverläufe begünstigen, andere hingegen destruktive Konfliktverläufe wahrscheinlich machen.
Der Artikel ist open access hier verfügbar.
Im September 2022 hielt Eva Eichenauer einen Vortrag auf der Tagung „Gute Stadt-Land-Beziehungen für eine nachhaltige Entwicklung in MV“, der gemeinsam von den Projekten ReGerecht, VoCo, Prosper-Ro organisiert wurde. In ihrem Beitrag mit dem Titel „Gute Bedingungen für regionale Wertschöpfung aus Windkraftanlagen“ berichtete sie über erste Erfahrungen mit der Anwendung des Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern, das eine verpflichtende finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen für Gemeinden und Anwohner*innen vorsieht.
Weitere Informationen zur Tagung, eine Videodokumentation, sowie den Tagungsband finden Sie auf der Tagungswebseite.
Die historische Entwicklung der Energieversorgung und Energiewende im Kontext der Wiedervereinigung beleuchten Eva Eichenauer und Prof. Dr. Ludger Gailing in ihrem Beitrag zum Online-Dossier „Der lange Weg der deutschen Einheit“ der Bundeszentrale für politische Bildung.
Abzurufen ist der Artikel unter https://www.bpb.de/themen/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/504994/energiesystem-und-energiewende/.
Gemeinsam mit Dr. Timmo Krüger (Bauhaus-Universität Weimar) geben Eva Eichenauer und Prof. Dr. Ludger Gailing den Special Issue „Just Energy Futures“ in der Zeitschrift Futures heraus. Die darin zusammengeführten acht Forschungsartikel beleuchten gerechte Energiezukünfte aus unterschiedlichen theoretischen wie empirischen Blickwinkeln und leisten einen wertvollen Beitrag zur kritischen Befassung mit Energiegerechtigkeit im globalen Kontext.
Link zum Special Issue: https://www.sciencedirect.com/journal/futures/special-issue/10QJCMS0J78
Krüger, T. / Eichenauer, E. / Gailing, L. (2022): Special Issue: Just Energy Futures. (Futures) Editor.
Krüger, T. / Eichenauer, E. / Gailing, L. (2022): Whose future is it anyway? Struggles for just energy futures. Futures, 142(103018), DOI: https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.103018
Ebenfalls vertreten ist das ReGerecht-Projekt in der im Oktober 2021 erschienenen dritten Folge des Podcasts Windrad sucht Standort der Forschungsgruppe MultiplEE "Nachhaltiger Ausbau erneuerbarer Energien mit multiplen Umweltwirkungen – Politikstrategien zur Bewältigung ökologischer Zielkonflikte bei der Energiewende". Jan-Niklas Meier spricht hierbei mit Eva Eichenauer über vor Ort be- und entstehende Konflikte an geplanten Windenergiestandorten.
Die Podcast-Folge kann hier angehört werden.
Im September 2020 veröffentlichten Eva Eichenauer und Prof. Dr. Ludger Gailing ein Policy Paper zur finanziellen Beteiligung an Windkraftanlagen. Im Rahmen des Projektes ReGerecht analysierten sie erste Erfahrungen mit dem Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern. Das Policy Paper gibt konkrete Umsetzungshinweise zu einer gerechten Gestaltung finanzieller Beteiligung aus kommunaler Sicht.
Eichenauer, E. & Gailing, L. (2020). Gute Bedingungen für lokale Wertschöpfung aus Windkraftanlagen. Erfahrungen und Empfehlungen. IRS Dialog Policy Paper, Erkner: Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung.
Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie hier:
Linking Borderlands: Dynamiken grenzregionaler Peripherien
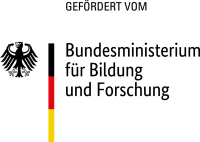
Projektleitung an der BTU: Prof. Dr. Ludger Gailing
Themenschwerpunkt „Policy Borderlands“: Martin Reents, Dr. Peter Ulrich (assoziierter Forscher)
Themenschwerpunkt „Energy Borderlands“: Kamil Bembnista, Prof. Dr. Ludger Gailing
Verbundpartner: Universität des Saarlandes (Verbundkoordination), Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Technische Universität Kaiserslautern
Projektpartner:
BTU Cottbus-Senftenberg: Prof. Dr. Ludger Gailing und Dr. Peter Ulrich
Universität des Saarlandes: Prof. Dr. Florian Weber (Verbundkoordinator), Prof. Dr. Astrid Fellner, Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann und Dr. Peter Dörrenbächer
TU Kaiserslautern: Prof. Dr. Karina Pallagst, Prof. Dr. Georg Wenzelburger und Dr. Kirsten Mangels
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder): Prof. Dr. Nicole Richter und Dr. Konstanze Jungbluth
Vernetzungspartner: Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION, UniGR-Center for Border Studies, Kommunalwissenschaftliches Institut Universität Potsdam
Förderorganisation: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Rahmenprogramm für die Geistes- und Sozialwissenschaften (2019 bis 2025) „Gesellschaft verstehen – Zukunft gestalten“, Fördermaßnahme auf dem Gebiet der Regionalstudien „Area Studies“
Laufzeit: 04/2021 - 03/2024
Das Verbundprojekt „Linking Borderlands: Dynamiken grenzregionaler Peripherien“ untersucht und vergleicht interdisziplinär den deutsch-polnischen mit dem deutsch-französischen Grenzraum miteinander in verschiedenen Teilbereichen (Policy-Transfer und -Lernen, soziale Praxis und Sprache im Berufsbildungskontext, kulturelle Aushandlungsprozesse im Film, Planungskulturen, Energietransitionen). Der Forschungsverbund wird an der Universität des Saarlandes koordiniert und umfasst an der westdeutschen Grenze noch die TU Kaiserslautern und an der ostdeutschen Grenze die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und die BTU. Die BTU koordiniert die Teilbereiche „Energy Borderlands“ und „Policy Borderlands“, die jeweils mit einer Partneruniversität in der westdeutschen Grenzregion gemeinsam bearbeitet werden. Der Schwerpunkt „Policy Borderlands“, der von der BTU in Kooperation mit der TU Kaiserslautern durchgeführt wird, verbindet die anderen Teilbereiche im Bündnis miteinander theoretisch-konzeptionell.
Das Projekt zielt darauf ab, einen Fokus auf europäische Grenzregionen als Kontaktzonen und Übergangsbereiche an nationalstaatlichen Rändern zu richten. So können fortbestehende Entwicklungspfade sowie Umbrüche in den so genannten Borderlands beleuchtet werden. Den gemeinsamen Zugang bilden die Border Studies, die sich verstärkt seit den 1990er Jahren konstruktivistisch ausgerichtet weiterentwickelt haben und eine interdisziplinäre Bearbeitung grenzregionaler Fragen ermöglichen.
Das Verbundvorhaben wird durch das BMBF auf dem Gebiet der Regionalstudien „Area Studies“ gefördert. Mit dem Rahmenprogramm für die Geistes- und Sozialwissenschaften (2019 bis 2025) „Gesellschaft verstehen – Zukunft gestalten“ sollen u.a. Vorhaben auf dem Gebiet der Regionalstudien gefördert und an Universitäten gestärkt werden sowie der Transfer hinsichtlich Gesellschaft und Politik gefördert werden.

Nachrichten aus dem Projekt
Vorstellung der Ergebnisse aus dem Verbundprojekt im Sammelband
Unter dem Titel "Linking Borderlands. Komplexität – Dynamik – Interdisziplinarität" ist ein Sammelband zu den Ergebnissen des Projektes erschienen. Hierin wird die Bedeutung der europäischen Grenzregionen SaarLorLux+ und Brandenburg/Lubuskie als Kontakt- und Übergangszonen thematisiert. Die einzelnen Beiträge erweitern die theoretischen Grundlagen der Border Studies und zeigen praktische Anwendungsfelder in den Bereichen Politiktransfer und Lernen, soziale Praxis und Sprache im Kontext beruflicher Bildung, kulturelle Aushandlungsprozesse im Film, Planungskulturen und Energiewende auf. Der Sammelband steht auf der Webseite des Nomos-Verlags als Open-Access-Download zur Verfügung.
Energy-Borderlands-Subprojekt „Filmwork - Dreiländerdreieck“
Vom 31.05.-02.06.2023 wurde für Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen der Oberschule Weinau in Zittau, sowie der Grundschule Nr. 5 Boleslawa Chrobrego in Bogatynia (Polen) ein Filmworkshop angeboten. Das vom Deutsch-polnischen Jugendwerk geförderte Vorhaben, welches gleichzeitig Subprojekt des BMBF-Projekts „Energy Borderlands“ darstellte, nahm sich zum Ziel Zukunftsvisionen mit den Teilnehmenden grenzüberschreitend zu denken. Dabei wurden mit den Teilnehmenden ortsbezogene (ökologische) Herausforderungen der Region diskutiert und filmisch unter dem Motto "Zukunft im Dreiländereck in Zeiten der Energiewende“, unter fachkundiger Anleitung von Kamil Bembnista (Dokumentarfilmregie, Grenzforschung), Joanna Piechotta (Kamera) und Hanna Schudy (Umweldforschung), herausgearbeitet. Den Jugendlichen wurde auf diese Weise ermöglicht, einerseits die medialen und konzeptionellen Prozesse des Filmemachens kennen zu lernen, anderseits das Thema der Energietransformation in grenzübergreifenden Kontext und der Frage der Zukunft des Dreiländerecks zu beleuchten. Thematischer Hintergrund war dabei der internationale Disput um den Braunkohletagebau Turów, welcher in den kommenden Jahren seine Stellung als Wirtschaftsmotor der Region verlieren wird und Zukunftsvisionen daher neu gedacht werden müssen.
Die Inhalte des Workshops wurden einerseits spielerisch angegangen, andererseits das Thema um die Energiewende mit der nötigen Portion an Reflexion diskutiert. Anhand von Beispielen aus den Genren interaktive Reportage und Dokumentarfilm, wurden zunächst auf die Herausforderungen und Chancen der Grenzregion in Hinblick auf Umwelt und Energiewende aufmerksam gemacht. Dabei kamen die Teilnehmenden schnell zu dem gemeinsamen Schluss, dass der Abbau Braunkohle auf der polnischen Seite aktuell eine wesentlich größere Rolle spiele, als auf der deutschen Seite. Die Tradition der „Braunkohle“ sei aber auf beiden Seiten gleichermaßen vorhanden.
In einer anschließenden Einführung in die Filmtechnik, bekamen die Teilnehmenden die Möglichkeit auf das Alter abgestimmte Details kennenzulernen und selbst auszuprobieren. In den Kleingruppen wurden anschließend Materialien mit Schüler*innen und Lehrer*innen auf dem Schulgelände, Passant*innen, Verkäuferinnen und Bewohnern der umliegenden Häuser gedreht. Inhaltlich wurden Themen um die Zukunft der Grenzregion, Energiewende, aber auch Ereignisse, die die Grenzregion prägten, sowie die Neißeflut aus dem Jahr 2010, angeschnitten. Mit teils experimentellen Vorgehen, inszenierten die Teilnehmenden sogenannte Schnittbilder um den Narrativen aus den Interviews Ausdruck zu verleihen. Die Ergebnisse der Aufnahmen wurden schließlich in einer Abschlusssichtung gemeinsam gesichtet und ausgewertet.
Panel und Vorträge bei Konferenz in Saarbrücken der BTU-Teilbereiche „Energy Borderlands“ und „Policy Borderlands“
Bei der „Border Renaissance“-Konferenz in Saarbrücken (4./5.2.2022) haben Kamil Bembnista und Peter Ulrich eine Session zu „Multidimensionale (Grenz-) Raumdiskurse“ organisiert und moderiert und Vorträge gehalten zu den Themen „Transitionsdiskurse grenzregionaler Energieräume. Eine vergleichende Perspektive des deutsch-französischen und deutsch-polnischen Grenzraums” (Kamil Bembnista) und „EU-Grenzräume als mehrdimensionale Arenen des Policy-Lernens, -Transfers und –Innovation. Eine vergleichende Perspektive des deutsch-französischen und deutsch-polnischen Grenzraums” (Peter Ulrich).
Vorträge auf europäischer und regionaler Ebene vor Praxisakteur*innen
Peter Ulrich hat am 29.10.2021 eine Delegation Brandenburgischer privater/öffentlicher und non-profit Institutionen an der Europa-Universität Viadrina empfangen, um Sie über laufende Forschungsprojekte zum deutsch-polnischen Grenzraum zu informieren. Teilnehmende waren u.a. aus dem privatwirtschaftlichen Bereich Banken, Wirtschaftsförderung und Vertreter*innen der Investitionsbank des Landes Brandenburg, aus dem öffentlichen Bereich aus verschiedenen Brandenburger Ministerien (u.a. Innern und Kommunales, Infrastruktur und Landesplanung, Wirtschaft, Arbeit und Energie, Finanzen und Europa u.a.).
Am 20.10. haben Ludger Gailing, Kamil Bembnista und Peter Ulrich einen Vortrag zu „Socio-spatial challenges in the energy transition in border regions“ auf der hybriden Konferenz „Association of European Border Regions (AEBR) Cross-Border School. Governance of the Green Deal in border regions“ durchgeführt. Die Veranstaltung, die in Arnhem stattfand, brachte Wissenschaftler*innen und Praxisakteure von der europäischen, nationalen und regionalen Ebene zusammen. Im Rahmen des Vortrags haben die Themenschwerpunkte „Energy Borderlands“ und „Policy Borderlands“ des Projekts „Linking Borderlands“ miteinander kooperiert.
Am 14.10.2021 hat Peter Ulrich mit einem Vortrag aktiv an der EU Week of Regions and Cities (EWRC) teilgenommen, die vom Ausschuss der Regionen und der Generaldirektion Regionalpolitik der EU organisiert wird und vom 11.-14. Oktober 2021 online (normalerweise in Brüssel) stattfand. In dem gemeinsamen Panel zu “Citizens at the forefront of the development of cross-border living areas”, das zusammen mit dem Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN), der Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), dem Euro-Institut Kehl und der Association of European Border Regions (AEBR) organisiert wurde, kommen verschiedene Vertreter*innen aus Wissenschaft und Politik zu Fragen von Politik & Zivilgesellschaft in (Grenz)Regionen und Europa ins Gespräch. Der Titel der Präsentation von Peter Ulrich lautet „Citizens’ engagement towards post-pandemic cross-border public services? Case study of the Polish-German border”.
Publikation und Vorträge zu 30-jährigem Jubiläum der deutsch-polnischen Beziehungen
Zu dem 30-jährigem Bestehen des deutsch-französisch-polnischem Weimarer Dreieck hat Peter Ulrich zusammen mit Birte Wassenberg (Uni Strasbourg) einen dreisprachigen (deutsch, französisch und polnisch) Beitrag „Der Eurodistrikt Strasbourg-Kehl/Ortenau: Modell für ein »lokales« Weimarer Dreieck?“ in der Publikationsreihe „30 Jahre Weimarer Dreieck: Idee von gestern oder Konzept für morgen?“ der Stiftung Genshagen am 16.6. veröffentlicht: http://www.stiftung-genshagen.de/publikationen/publikation-detailansicht/00da24978daea266117e576eca547660.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2151 Die Stiftung Genshagen hat im Nachgang dazu Peter Ulrich am 15.-16.11.2021 zum Workshop “Grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Deutschland, Frankreich und Polen” ins Schloss Genshagen eingeladen, wo er das Panel zu „Beispiele grenzüberschreitender Zusammenarbeit: Gesundheitswesen als prioritäres Handlungsfeld“ mit Vertretern u.a. von der Euroregion Spree-Neiße-Bober moderiert hat. An dem Workshop haben Wissenschaftler*innen, Praxispartner*innen und politische Entscheidungsträger*innen der deutsch-polnischen Beziehungen teilgenommen.
Des Weiteren hat Peter Ulrich zum 30.Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags auf der hybriden Veranstaltung „Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit? 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft“ (organisiert vom Deutschen Polen-Institut) in Warschau am 18. Juni 2021 einen Vortrag zum Thema „Die gesellschaftliche Dimension deutsch-polnischer grenzüberschreitender Zusammenarbeit“ gehalten. Der Vortrag und die Veranstaltung ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=CTrdLSCPWlA&t=13814s
Am 30.Juni 2021 hat er außerdem einen Beitrag zu „30 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag: State of the Art oder Aktualisierungsbedarf?“ beim Workshop „30 Jahre Deutsch-Polnischer Vertrag: Wo stehen wir? Polen in Deutschland, deutsche Minderheit in Polen. Über Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden“ organisiert vom polnischen Sozialrat gehalten.
Publikation zu „verflechtungssensiblen Maßnahmenräumen in der Corona-Pandemie“ bei BBSR-Publikation und Vorträge dazu beim ARL-Kongress 2021 und beim 28. Wissenschaftlichen Kongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
Zusammen mit Norbert Cyrus hat Peter Ulrich einen Beitrag in der aktuellen Ausgabe von „Informationen zur Raumentwicklung“ (IzR) des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung publiziert. In der Ausgabe 2/2021 zum Thema „Grenzerfahrungen“ thematisieren sie unter dem Titel „Verflechtungssensible Maßnahmenräume. Lehren aus dem Umgang mit der COVID-19-Pandemie in der Doppelstadt Frankfurt (Oder) und Słubice“ resiliente grenzübergreifende Raumplanung und Daseinsvorsorge. Die Ergebnisse der Studie wurden beim ARL-Kongress 2021 „Im Zeichen der Pandemie. Raumentwicklung zwischen Unsicherheit und Resilienz“ am 2.7. unter dem gleichen Titel wie im Heft präsentiert. Auch beim 28. Wissenschaftlichen Kongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) wurde das Thema aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive unter dem Thema „Grenzregionale Räume der Krisenbewältigung. Politik, Verwaltung und Gesellschaft an der Grenze zu Polen“ vorgestellt und diskutiert.
Bericht über Peter Ulrich in der Märkischen Oderzeitung und der Lausitzer Rundschau
Am 21.4. und 4.6.2021 berichten die Märkische Oderzeitung und die Lausitzer Rundschau über die Arbeit von Dr. Peter Ulrich. Es wird eine vergleichende Studie zur Corona-Situation im deutsch-polnischem und anderen Grenzräumen Deutschlands vorgestellt. Die Online-Versionen finden Sie unter https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/corona-in-brandenburg-grenze-zu-und-mehr-geht-nicht_-wissenschaftler-vergleicht-pandemie-reaktionen-unterschiedlicher-grenzgebiete-56379347.html und unter https://www.lr-online.de/nachrichten/brandenburg/corona-in-polen-gibt-es-alternativen-zu-grenzschliessungen-in-der-pandemie_-57243051.html
DigPion – Digitale Pioniere in der ländlichen Regionalentwicklung
Projektleitung an der BTU: V-Prof. Dr. Julia Binder
Projektteam: Kamil Bembnista, Julia Zscherneck, Hanna Zeißig und Isabelle Krebs
Förderorganisation: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Förderlinie Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE+)
Link zur Fördermaßnahme: https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/BULE/Foerdermassnahmen/Forschungsvorhaben/Digitalisierung.html
Laufzeit: 04/2020 - 04/2023
Das am Fachgebiet Regionalplanung der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg angesiedelte BULE/BMEL-Forschungsprojekt DigPion (4/2020-3/2023) analysiert die Netzwerke und Kooperationsstrategien digitaler Vordenker im ländlichen Raum. Dazu werden digitale Pionierinnen und Pioniere mit IKT-Kenntnissen in den Fallregionen Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg identifiziert, die soziale Innovation und regionale Entwicklung in ländlichen Regionen vorantreiben. Aufbauend auf Interviews mit den Pionierinnen und Pionieren werden ihre Netzwerke und Kooperationen systematisch mit netzwerkanalytischen Methoden untersucht. Ziel des Projekts ist es, politische Strategien zu entwickeln, die eine nachhaltige räumliche Entwicklung fördern und räumliche Disparitäten verhindern können.

Nachrichten aus dem Projekt
Im Rahmen des 3. BULE+ Vernetzungstreffens vom 13.-15.03.2023 in Göttingen stellten V.-Prof. Dr. Julia Binder und Hanna Zeißig die Konzeption des Projekts "Digitale Pioniere in der ländlichen Regionalentwicklung“ sowie die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen aus dem Projekt vor. Zusammen mit den weiteren Forschenden unterschiedlicher Disziplinen, die in der Forschungsfördermaßnahme „Ländliche Räume in Zeiten der Digitalisierung“ vereint sind, konnten Forschungs- und Projektergebnisse ausgetauscht und Synergien hergestellt werden.
Im Rahmen des 41. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) in Bielefeld, stellten Kamil Bembnista und Dr. Tobias Mettenberger die Konzeption des Projekts "Digitale Pioniere in der ländlichen Regionalentwicklung“, sowie erste Ergebnisse einer egozentrierten Netzwerkanalyse vor. Unter dem Titel "Die Netzwerke ländlicher Digitaler Pionier*innen. Eine Kontextualisierung zwischen Regionalität und Cyberspace“ wurden dabei Ursachen und Konsequenzen einer innovationshemmenden Umgebung interpretiert, sowie welche Rolle Nähe und Distanz im physischen sowie im digitalen Raum spielen, dass hilfreiche Ego-Alteri-Beziehungen geknüpft und gepflegt werden. Die Präsentation fand im Rahmen der Sektion Soziologische Netzwerkforschung unter dem Titel Wechselwirkungen von sozialen Netzwerken und deren Kontexten statt.
Im Rahmen des ARL-Kongresses 2022 „Künftig alles SMART? – Herausforderungen der Digitalisierung für die Raumentwicklung“ in Bielefeld präsentierte das DigPion-Projekt um Julia Zscherneck & V-Prof. Dr. Julia Binder in Kooperation mit Dr. Tobias Mettenberger (Thünen Institut) Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt. In ihrem Vortrag beleuchteten sie die Fragen, welche Ressourcen digitale Pionier*innen von der Politik und Regionalentwicklung benötigen und inwieweit sie eigene Ressourcen und Netzwerke einbringen, um die Region zu entwickeln.
Vom 07. bis 10. Juni 2022 nahm das DigPion-Projekt an der „6th Global Conference on Economic Geography“ in Dublin, Irland teil. Die erste internationale Konferenz in Präsenz nach der pandemiebedingten Pause war für alle Beteiligten etwas Besonderes und bot dem Team die Möglichkeit, ihre Zwischenergebnisse im internationalen Kontext zu präsentieren. Der Vortrag beschäftigte sich mit der Rolle der digitalen Pionier*innen in ländlichen Regionen und ihren technisch-digitalen, politisch-administrativen, finanziellen und wissenschaftlichen Ressourcen.
Unter dem Titel „Digitale Pionier:innen und ihr Wirken in der Region. Wissenschaftlich-basierte Handlungsempfehlungen gerichtet an Politik und ländliche Regionalentwicklung“ hat das DigPion-Projektteam Anfang Mai zwei Workshops in den Fallregionen im nordöstlichen Baden-Württemberg (Künzelsau) und dem südöstlichen Mecklenburg-Vorpommern (Neubrandenburg) mit den im Forschungsprojekt identifizierten digitalen Pionier:innen durchgeführt. Die Workshops zielten darauf ab, Handlungsempfehlungen für die politische Praxis auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene und die ländliche Regionalentwicklung basierend auf den Forschungsergebnissen des Projekts „DigPion - Digitale Pioniere in der ländlichen Regionalentwicklung“ (2020-2023) kollaborativ zu erarbeiten. Die Workshops fanden im hfcon (Künzelsau) und am Innovationszentrum Neubrandenburg mit zentralen digitalen Pionier:innen verschiedener Bereiche (Gesundheit, Landwirtschaft, Entrepreneurship, Co-Working und Mobilität) statt.
Am 17. November 2021 hat Dr. Tobias Mettenberger im Rahmen der IRS-Konferenz „On-/Offline Interferences“ beim Workshop „COVID and what next? Methodological implications for digitalisation research in rural-peripheral areas“, der von Dr. Julia Binder vom Fachgebiet Regionalplanung der BTU in Kooperation mit Dr. Ariane Sept, Prof. Dr. Gabriela Christmann und Prof. Dr. Heike Mayer organisiert wurde, einen Vortrag zum Thema „Analysing digital pioneers in rural areas from my big city home office – How the pandemic shaped the issue and the methodology of an ongoing research project“ gehalten.
Das DigPion-Projekt war im Rahmen der IÖR-Jahrestagung, die zwischen dem 22.-24. September 2021 in Dresden stattfand, vertreten. Dr. Tobias Mettenberger, Dr. Julia Binder und Julia Zscherneck hielten dort einen Vortrag zu „Digitale Pionier*innen als Schlüsselfiguren für nachhaltige ländliche Entwicklung?“.
Im Rahmen des virtuellen gemeinsamen Soziologiekongresses „Post-Corona-Gesellschaft“ der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie (ÖGS) in Wien war das Projekt mit einem virtuellen Beitrag vertreten. Dr. Tobias Mettenberger, Dr. Julia Binder und Julia Zscherneck hielten einen Vortrag zu „Räumliche Nähe und Distanz in den Netzwerken ländlicher Digitaler Pioniere“. Die Konferenz fand zwischen dem 23.-25. August 2021 statt.
Bei der Konferenz "Sustainable & Resilient Urban-Rural Partnerships – URP2020" war das DigPion-Projekt mit dem Vortrag von Dr. Ariane Sept und Dr. Julia Binder "Smart Villages - Catalysts of inclusive development?" im URP 2020 Programm vertreten. Die URP 2020 fand vom 26. bis 27. November 2020 digital in Leipzig statt. Weitere Informationen zur Session können Sie dem folgenden Handout entnehmen.
WIR! - region 4.0 - Verbundprojekt: Weiterentwicklung der Innovationsstrategie; TP2: Innovationsumfeld und Governance
Projektleitung an der BTU: Prof. Dr. Ludger Gailing
Projektteam: Sunna Kovanen, Dr. Peter Ulrich
Verbundpartner: Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) (Koordination), Zentrum für Technik und Gesellschaft (TU Berlin), Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Investor Center Uckermark GmbH, Stadtwerke Schwedt GmbH, Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH, pro agro – Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e.V.
Förderorganisation: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Fördermaßnahme „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“
Laufzeit: 09/2019 - 09/2022
Das Projekt „region 4.0“ ist ein Bündnis des BMBF-Programms „Wandel durch Innovation in der Region“ (WIR!), das verschiedene Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis aus Berlin und Brandenburg zusammenbringt. Das Ziel des WIR!-Bündnisses ist es, eine Innovationsstrategie „region 4.0“ umzusetzen, die die Entwicklung innovativer Wertschöpfungsnetze in verschiedenen Handlungsfeldern, u.a. Land- und Ernährungswirtschaft und Daseinsvorsorge/Infrastruktur in der Umsetzungsregion bestehend aus den Landkreisen Barnim und Uckermark in Brandenburg und dem ehemaligen Landkreis Uecker-Randow in Mecklenburg-Vorpommern beinhaltet.
Die BTU ist hauptverantwortlich für das Teilvorhaben „Innovationsumfeld und Governance“, das innerhalb des Bündnisses „region 4.0“ Bestandteil des Verbundvorhabens „Weiterentwicklung der Innovationsstrategie“ ist. Der Beitrag der BTU besteht in der Begleitung und wissenschaftlichen Fundierung der Arbeit des WIR!-Bündnisses im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Innovationsstrategie. Der forschungszentrierte Projektbeitrag der BTU ist die empirische und methodische Verknüpfung dreier Perspektiven in regionalen Innovationsprozessen: wissenschaftliche Aufbereitung zu Innovationen in „organizationally thin regions“, Umfeldanalyse und -begleitung mit Governance-Akteuren in der Umsetzungsregion und Vergleich mit anderen „organizationally thin regions“ in Deutschland. Des Weiteren unterstützt die BTU bei der Verstetigung des Innovationsmanagements in der Region.

Nachrichten aus dem Projekt
Anlässlich des Projektabschlusses wurden drei Artikel in den wissenschaftlichen Fachzeitschriften RaumPlanung, Frontiers in Political Science und PLANERIN publiziert. Die Veröffentlichungen berichten von den gewonnenen Erkenntnissen aus dem Projekt und beschäftigen sich thematisch mit regionalen Wertschöpfungsnetzen sowie dem Einsatz kollaborativer, regionaler Governance und regionaler Innovationsstrategien:
- Gailing, L. (2023): Regionale Wertschöpfungsnetze im ländlichen Raum. Das Bündnis "region 4.0" als Motor für Kooperation und Transformation. PLANERIN, 2(2023), 34-36.
- Kovanen, S., Ulrich, P., & Gailing, L. (2023): Institutionalizing collaborative regional governance in organizationally thin regions – Regional development agencies and the neglect of social innovations. Frontiers in Political Science (Section Comparative Governance), 5(1092295), DOI: 10.3389/fpos.2023.1092295
- Nagy, E., Kovanen, S., Schäfer, M., & Gailing, L. (2023): Innovationen in ländlichen Räumen etablieren? Erkenntnisse aus der Umsetzung und Weiterentwicklung einer regionalen Innovationsstrategie. RaumPlanung, 220(2023), 49-54.
Am 18.11.2021 wurden die Ergebnisse der Feldforschung im Rahmen des Teilprojekts "Innovationsumfeld und Governance" bei der internationalen Konferenz & Festival "GRASP - A Festival of New Ideas" von der Universität Roskilde und Roskilde Festival, Dänemark präsentiert.
Am 15.11. wurde ein Workshop zwischen dem Bündnis WIR! Region 4.0 und dem Investor Center Uckermark in Schwedt (Oder) durchgeführt, um die Verstetigung des Bündnisses nach der ersten Förderperiode zu planen. Der Workshop wurde inhaltlich vom BTU-Team des Bündnisses vorbereitet.
Im Rahmen des Verbundvorhabens „Weiterentwicklung der Innovationsstrategie“ der ZTG an der TU Berlin und des Fachgebiets Regionalplanung ist ein Reflexionspapier entstanden, dass dem WIR!-Bündnis zur Verfügung gestellt wurde. Das Fachgebiet Regionalplanung hat das „Innovationsumfeld und Governance“ in der Umsetzungsregion untersucht:
Schäfer, Martina, Nagy, Emilia, Gailing, Ludger, & Ulrich, Peter (2021): Empfehlungen an das WIR!-Bündnis „region4.0“ auf Basis der formativen Evaluation und der Governance-Analyse des Innovationsumfelds. Ein Feedback Loop Paper.
Das WIR!-Bündnis „region4.0“ führte im Rahmen des „14. Zukunftsforum ländliche Entwicklung“ am 21.01.2021 unter dem leitenden Thema „Alles digital oder doch wieder "normal"? Neue Formen von Arbeit und Teilhabe als Chance für die Ländlichen Räume“. Unter dem Titel „region 4.0 – regionales Innovationsnetzwerk digital“ war auch das Fachgebiet Regionalplanung vertreten bei diesem Fachforum.
Die Präsentation und Beiträge können hier nachträglich angeschaut werden.
Deutsch-polnische Konferenz „In 90 Minuten von Berlin nach Szczecin“
Projektteam an der BTU: Martin Reents, Leonard Weiß
Verbundpartner: Universität Szczecin (Institute of Spatial Management and Socio-Economic Geography), Universität Potsdam (Kommunalwissenschaftliches Institut)
Förderorganisation: Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung
Laufzeit: 10/2024 - 03/2025
Die Bahnstrecke Berlin-Szczecin wird zukünftig eine schnellere Verbindung zwischen den beiden Städten ermöglichen. Bereits heute zeichnen sich in der Verflechtungsregion entlang der Strecke lokale Veränderungsdynamiken ab – etwa der wachsende Tourismus in Westpommern, der geplante Hafenausbau in Szczecin und Świnoujście und die Transformationsprozesse in Schwedt/Oder verändern die grenzüberschreitende Metropolregion nachhaltig. Diese Veränderungen werfen neue Fragen zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zusammenarbeit auf, die im Rahmen einer zweitägigen, deutsch-polnischen Konferenz in Szczecin im Mittelpunkt standen.
Die Idee zur Konferenz entstand aus den Forschungen und Kooperationen im Rahmen des Projekts "Cross-InnoNet: Grenzüberschreitende Daseinsvorsorge Berlin-Szczecin" und wurde gemeinsam mit dem Institute of Spatial Management and Socio-Economic Geography der Universität Szczecin und dem Kommunalwissenschaftlichen Institut der Universität Potsdam umgesetzt und gefördert durch die Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung. Ziele der zweitägigen, deutsch-polnischen Veranstaltung waren die Sichtbarmachung aktueller regionaler Trends und Projekte, immer mit grenzüberschreitendem Bezug zur im Ausbau befindlichen Bahnstrecke sowie die Diskussion zukünftiger Handlungsfelder und strategischer Ansätze.